Machen wir uns nichts vor: Wer Freiheit liebt, lehnt Dialekt nicht ab. Denn Dialekte sind keine sprachlichen Zufälligkeiten oder sentimentalen Überbleibsel aus alten Tagen. Sie sind Widerstandsformen. Ausdruck gelebter Selbstbestimmung. Kleine, aber standhafte Bastionen gegen die stetig fortschreitende Gleichmacherei.
In Zeiten von woker Sprachregeln und pseudouniformer Medienkultur lohnt der Blick zurück – und nach unten. Dort, wo das Leben tatsächlich stattfindet: auf dem Land, in den Regionen, bei den Menschen, die noch wissen, was ein „Gscheidhaferl“ ist.
Eine medial kaum beschriebene, aber dialektal umso aufschlussreichere Verwirrung war die Wahl des Herrn Sesselmann zum Landrat. Normalerweise wäre das keine Meldung. Da er aber AfD-Politiker ist, fühlten sich die „Guten“ im Lande aus Angst vor der Machtübernahme genötigt, auf die Straßen zu gehen. So weit, so krude. Doch was den wenigsten aufgefallen ist: Die Menschen in Sonneberg sprechen – oder wie man in Oberfranken sagt, „plaudern“ – fränkisch! Grenzen können Dialekte nicht aufhalten, was man auch an den Landstrichen Franken und Hessen, Franken und Württemberg – und sicher auch noch jenseits des schönen Frankenlandes – beobachten kann.
Der Grund für diese dialektale Präzedenzlosigkeit ist die Geschichte. Anders als Frankreich oder Großbritannien war Deutschland nie ein zentralistischer Staat. Das Heilige Römische Reich war ein Flickenteppich – im Bairischen könnte man sagen „Flickerlteppich“ – mit über tausend kleinen und größeren Herrschaften, jede mit eigener Verwaltung, eigenem Kalender und eben auch eigener Sprache. Diese sprachliche Dezentralität war kein Fehler. Sie war die Folge politischer Vielfalt. Und diese Vielfalt bedeutete: Freiheit.
Hochdeutsch, die Sprache der Obrigkeit
Im Dialekt sprach man, wie man dachte. „Wie der Schnobel eam gewachsn is“. Ohne Rücksicht auf Oberlehrer oder Sprechakademien. Die Zunge war frei – und mit ihr der Kopf.
Eine Freiheit, die uns selbsternannte Tugendwächter heute wieder nehmen wollen. Sei es durch das vermaledeite Gendern oder durch das Sanktionieren von Menschen, die es wagen, Wörter wie „Neger“, „Mohr“ oder „Zigeuner“ zu gebrauchen – Wörter, die angeblich marginalisierte Gruppen beleidigen sollen. Was nicht wenige aus den sogenannten marginalisierten Gruppen ganz anders sehen.
Zurück zur Geschichte Deutschlands: Immer wieder versuchten Mächte, die Vielfalt zu unterdrücken. Die Preußen wollten Disziplin – auch sprachlich. Die Nazis setzten auf Gleichschaltung und misstrauten allem, was nach Region klang. In der DDR wurde der Dialekt als rückständig abgewertet. Und heute? Heute soll er angeblich nicht inklusiv genug sein.
Hochdeutsch ist zur Sprache der Obrigkeit geworden. Wer in Talkshows sitzt, hat zu gendern. Wer in Klassenzimmern steht, soll korrekt sprechen. Der Dialekt stört da nur. Denn er ist nicht kontrollierbar. Nicht normiert. Und vor allem: Er ist nicht belehrbar.
Gendern prallt ab
Besonders deutlich wird das am Beispiel Franken. Zwischen Bamberg, Coburg, Schweinfurt und Würzburg spricht kaum jemand gleich. Jeder Ort hat seinen eigenen Klang, seine eigenen Ausdrücke, seinen eigenen Stolz. Der Franke ist nicht laut, aber störrisch. Er passt sich ungern an – und das hört man auch. Ist man aber erst mal in seinem Herzen, so kommt man nicht mehr so schnell wieder raus.
Der berühmte fränkische Grant ist keine Laune. Er ist die sprachliche Form des zivilen Ungehorsams. Wenn der Franke sagt: „Bassd scho“, meint er oft das Gegenteil. Ironie, Skepsis, Lebensklugheit – alles verpackt in zwei Silben. Das muss man erst mal können. Und wenn er zu Ihnen sagt: „Net schlecht“, dann können Sie sich freuen. Denn soeben haben Sie das höchstmögliche Lob bekommen, das Ihnen ein Franke je kredenzen wird.
Dialekte haben durch ihren bockbeinigen Charakter aber auch noch andere Aufgaben. Denn wenn in der inneren Welt alles standardisiert wird – Sprache, Meinung, Geschlecht – ist der Dialekt ein letzter Freiraum. Er unterläuft die Sprachvorgaben, die uns von oben diktiert werden. Die Forderung nach gendergerechter Sprache etwa prallt am Dialekt ab wie Regen am Dach der Marienburg in Würzburg – falls es nicht mal wieder undicht ist.
Wer plaudert wie er will
Ich frage Sie: Wie will man das Gendersternchen in einen Satz wie „Der Bubb hot’s Bäggla voll“ einbauen? Richtig: Gar nicht. Und das ist gut so. Denn der Dialekt verweigert sich dem Umerziehungsprogramm.
Dialekte sind keine Bedrohung für die Einheit – sie sind ihr Fundament. Denn echte Demokratie lebt vom Streit, vom Gegensatz, vom Anderssein. Also von echter Diversität – jenseits der Regenbogen-Irren. Wer das Reden angleichen will, will auch das Denken angleichen. In der Schweiz gilt der Dialekt übrigens als Zeichen politischer Reife. In deutschen Parlamenten dagegen gilt er als peinlich. Warum? Weil man sich in Berlin offenbar davor fürchtet, dass jemand anders spricht – und womöglich auch anders denkt.
In der Schule wird Dialekt kaum mehr geduldet. In der Tagesschau hört man ihn nie. Und in Talkshows? Da dürfen Politiker aus Bayern auftreten – aber bitte mit abtrainiertem Akzent, der das schöne Bairisch nur noch simuliert.
Diese Auslöschung ist keine Naturerscheinung. Sie ist politisch gewollt. Eine Sprache, die nicht mehr stört, ist leichter zu kontrollieren. Der, der Hochdeutsch spricht, bei dem ist die Chance hoch, dass er wie der Staat spricht. Wer Dialekt plaudert, plaudert wie er will.
Konstruktiver Widerstand
Man kann alles standardisieren: Lebensmittel, Fernsehsendungen, Geschlechtsidentitäten. Aber wer die Sprache standardisiert, greift die Identität an. Ohne Dialekt keine Heimat. Ohne Heimat keine Verwurzelung. Ohne Verwurzelung kein Rückgrat. Und ohne Rückgrat haben wir Politiker wie Scholz, Merz, Klingbeil und Habeck – als zwangsläufige Folge.
Dialekte sind die letzte Volkskultur, die sich nicht kaufen lässt. Kein Konzern, keine NGO, keine Parteistiftung kann sie kolonisieren. Denn sie leben im Alltag. In der Familie. Auf dem Dorfplatz. In der Wirtschaft. Und dort werden sie auch überleben. Dialekte haben Kriege überlebt, echte Pandemien – und faschistoide Corona-Maßnahmen. Dialekte werden auch diese gruselige Regierung überleben.
Der Dialekt ist keine Macke von Allgäuer Kuhbauern. Er ist eine Form des bürgerlichen – also konstruktiven – Widerstands. Ein Zeichen von Mündigkeit. Wer Dialekt spricht, verweigert sich dem ideologischen Einheitsbrei. Er sagt nicht, was gesagt werden soll. Sondern was Sache ist.
Und wie sagt man in Franken, wenn man sich nicht beirren lässt?
„Mogsd net, machsd fei nix.“
Diesen Beitrag im Wurlitzer anhören:
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.
Alternativ können Sie den Podcast auch bei anderen Anbietern wie Apple oder Overcast hören.




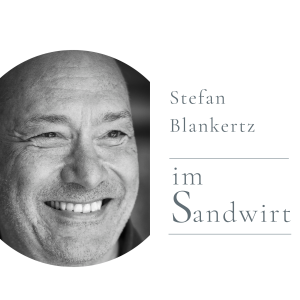
2 Kommentare. Leave new
Ich finde Dialekte ja auch schön, weil man damit Dinge sagen kann, die nicht jeder verstehen soll. Wäre auch mal interessant, ob „Dösbaddel“ so strafbar wäre wie „Schwachkopf“. Ansonsten: wenn es der oben angesprochene Personenkreis mit „bunt und vielfältig“ ernst meinen würde, würde er Dialekte feiern.
Ich unterstütze den Gedanken dieses Artikels vollauf, meine Erfahrungen mit dem Alemannischen bestätigen das alles. Die Welt des Dialekts ist eine Welt des Realismus und der Skepsis und der Eigenwilligkeit, die den irren Anmutungen der „Großkopfeten“ widersteht.
Ich möchte aber für etwas mehr Verständnis für Hochdeutsch werben: Es war ursprünglich nicht dazu gedacht, die lokalen Dialekte zu ersetzen, sondern dazu, eine gemeinsame Verständigung zu ermöglichen. Die Entwicklung zum Hochdeutsch begann mit der Bibelübersetzung Luthers. Im Grunde wächst der Deutsche auf diese Weise zweisprachig auf: In gesprochener Sprache Dialekt, in der Schriftsprache Hochdeutsch. In der Schweiz wird das regelrecht kultiviert: Wir sollten das auch tun! Ich behaupte, dass ich diesem zweisprachigen Aufwachsen einiges an sprachlicher Fähigkeit verdanke, das ich für andere Sprachen, auch alte Sprache, nutzen konnte. Der Satzbau im Lateinischen ist z.B. oftmals wie bei uns im Dialekt: Verrückt!
Auch Preußen wollte keinesfalls alles über einen Leisten schlagen. Das haben erst die Nazis getan, die die Bundesländer abschafften und durch „Gaue“ ersetzten, also zentral aus Berlin verwalteten Departments ähnlich wie in Frankreich. Die Shitbürger haben dann versucht, uns einzureden, dass es nicht nur die Nazis waren, sondern auch die Preußen und überhautp das deutsche Wesen insgesamt. Doch das ist falsch.
Ausgerechnet von Kaiser Wilhelm II. haben wir eines der schönsten Zeugnisse zugunsten von Regionalität aus unserer Geschichte: Göring besuchte Kaiser Wilhelm II. in seinem Exil in Doorn, um ihn für den Nationalsozialismus zu gewinnen, und hinterher sagte Wilhelm II.: „Zwei Stunden lang habe ich diesem Rindvieh klarzumachen versucht, dass man Deutschland nur auf der Grundlage des Föderalismus regieren kann.“