Die modernen Überwachungssysteme haben gleich zwei wirkmächtige Akteure: zum einen die Tech- und KI-Konzerne mit ihren ausgefeilten Methoden und zum anderen den bisweilen übergriffigen Staat. Die Bürger befinden sich in einer „Sandwich-Position“, während der Überwachungskapitalismus bizarre Blüten treibt.
Mitte 1949 veröffentlichte der britische Schriftsteller George Orwell seinen dystopischen Roman 1984, in dem er einen repressiven Staat beschreibt, dessen Regime die Menschen durch Überwachung, Propaganda und Manipulation kontrolliert und Widerstand mit Gewalt bricht. Es ist die Fiktion von einem totalitären Überwachungsstaat, in dem der „Große Bruder“ („Big Brother is watching you“) und seine alles kontrollierende und manipulierende Partei die absolute Macht innehaben.
Würde 1984 heute in einer aktualisierten Neuauflage erscheinen, wäre wohl nicht „Big Brother“ der alleinige Überwacher und Herr über die Daten seiner Untertanen, vielmehr käme diese Rolle einer „Big Family“ zu – einem Clan, zu dem die mächtigsten Tech- und KI-Konzerne zählen, aber auch immer mehr Staaten, die sich ausgeklügelte und KI-gestützte Überwachungstechnologien zu eigen machen, um ihre Bürger zu observieren, zu erziehen, zu gängeln, abweichende Meinungen zu unterdrücken und politisch unkorrektes Fehlverhalten zu sanktionieren. Dort, wo Big Tech auf Big Government trifft, wird es für die Menschen und deren Recht auf Selbstbestimmung zunehmend gefährlich. Die meisten Mitglieder der „Big Family“ haben ihren Sitz in den USA. Das derzeit mächtigste „Clanmitglied“ wäre dann wohl Nvidia, der führende Produzent von Chips für Künstliche Intelligenz (KI).
Die anderen Mitglieder tragen ebenfalls prominente Namen wie Alphabet (Google), Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Microsoft, Amazon, Apple und OpenAI, an dem wiederum Microsoft mit 49 Prozent beteiligt ist. Sie alle erzielen hohe Milliardenumsätze und verfügen damit nicht nur über extrem starke wirtschaftliche und technologische Potenz, sondern auch über nicht zu unterschätzenden politischen und gesellschaftlichen Einfluss. Sie haben eine weltweite Abhängigkeit ihrer Kunden aufgebaut, denn Milliarden Menschen nutzen Tag für Tag Produkte von Google, Apple und Microsoft sowie Dienste von Meta oder sie bestellen bei Amazon.
Aber auch Mitglieder aus dem fernen China gehören zum Tech- und KI-Familien-Clan. Sie können ebenfalls stolz auf zwei- oder dreistellige Milliarden-Dollar-Umsätze verweisen. Die führenden Konzerne aus dem Land der Mitte sind unter anderem Tencent, die Alibaba Group, ByteDance, Baidu und Huawei.
Daten sind die Währung der digitalen Welt
Mancher wird sich die Frage stellen, weshalb diese Konzerne ausgerechnet mit George Orwell verglichen werden. Schließlich machen High-Tech und KI unser aller Leben doch sehr viel einfacher. Ein Leben ohne Smartphones ist nicht mehr vorstellbar. Sie werden auf dem Schulhof ebenso verwendet wie im Altenwohnheim. Von WhatsApp oder Facebook plötzlich abgeschnitten zu sein, käme für die meisten fast einer Kontaktsperre gleich. Und wie einfach ist doch das Shoppen bei Amazon. Viele haben überdies längst die Vorteile von KI schätzen und lieben gelernt – sowohl im Job als auch privat. Das Stichwort heißt „Convenience“, auf Deutsch: Bequemlichkeit.
Und weil alles so schön bequem ist, geben wir auch gern viel von uns preis. Schließlich sind Dienste wie WhatsApp, Instagram, Facebook usw. ja kostenlos und finanzieren sich über Werbeeinnahmen. Doch das ist leider nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich bezahlen wir diese Dienste nur mit einer anderen Währung. Nicht mit Euro, Dollar oder Bitcoin, sondern mit unseren Daten. Denn Daten sind die Währung der digitalen Welt, und es gibt keine Notenbank, die sie steuern würde.
Arglos stellen die meisten von uns den führenden Big-Tech- und KI-Konzernen Tag für Tag ein Mega-Datenvolumen zur Verfügung – freiwillig und größtenteils, ohne dass wir es bemerken. Täglich werden Milliarden von Suchanfragen bei Google eingegeben. Die Suchmaschine registriert dabei nicht nur Worte, sondern auch deren Bedeutungszusammenhang, bisweilen auch „semantische Weltkarte“ genannt. Und wie durch Zauberhand ploppt dann plötzlich entsprechende Werbung auf. Aus unseren YouTube-Daten lässt sich das individuelle Seh- und Hörverhalten der User herausdestillieren. Dank Chrome und Android werden unsere App-Nutzung sowie unser jeweiliger Standort transparent. LinkedIn von Microsoft liefert Informationen über unsere Arbeit und Karriere, und per Amazon geben wir digitale Auskünfte über unser Konsumverhalten und unsere Produktsuche.
Durch diese Menge an Daten entstehen ziemlich detaillierte psychografische Profile. Dazu gehören Erkenntnisse über Werte und Einstellungen, Interessen und Hobbys, unseren Lebensstil und nicht zuletzt über unsere politische und weltanschauliche Einstellung. Wer an der Supermarktkasse mit Karte oder Smartphone zahlt, gibt überdies Daten über seine Konsumpräferenzen preis.
Wen sollte das interessieren, mag da mancher fragen. Nun, vielleicht die Krankenversicherung, die bei ungesunder Lebensweise eine neue Kalkulationsgrundlage für die Höhe der Beitragszahlungen hat, um nur ein Beispiel zu nennen. Solange es noch Bargeld gibt, können die Verbraucher damit weitgehend anonym einkaufen. Nach Einführung des digitalen Euro und zunehmenden Bargeldrestriktionen bis hin zur möglichen Cash-Verbannung ist es damit vorbei.
Big Government: Schutzmacht oder Überwachungsapparat?
Wer schützt uns vor all diesen Auswüchsen, vor der Totalüberwachung, dem Verlust unserer Selbstbestimmung und vor dem, was die US-amerikanische Sozialpsychologin Shoshana Zuboff als Zeitalter des Überwachungs-Kapitalismus bezeichnet? Ein Zeitalter, in dem – so ihre zentrale Aussage – das Individuum nicht mehr der Entscheidungsträger über seine Daten ist, die sich zum Rohstoff für eine neue Form der Macht entwickeln. Einer Macht, die sich der Kontrolle durch den Bürger entzieht.
Haben die Bürger in einem starken Staat eine wirkliche Schutzmacht? Wohl kaum, denn das Verhältnis zwischen Big Tech und Big Government ist ein symbiotisches. Das wissen oder ahnen viele Menschen und stellen sich die Frage, ob unsere Daten auch an Behörden weitergeleitet oder sogar an diese verkauft werden. Ja, zumindest indirekt. So können zum Beispiel Polizei und Geheimdienste Unternehmen per richterlicher Anordnung zur Herausgabe von Daten zwingen. Tatsächlich erhalten Meta, Google, Apple & Co. regelmäßig Anfragen von Behörden. Das freilich ist noch die vergleichsweise harmlose Form dieser Symbiose. Wesentlich besorgniserregender für jeden selbstbestimmt lebenden und freiheitsliebenden Bürger ist die Instrumentalisierung von High-Tech und KI zur Optimierung des Überwachungsstaates. Beispielhaft sei an dieser Stelle nur das US-amerikanische Softwareunternehmen Palantir erwähnt, dessen Big-Data-Produkt Gotham maßgeschneidert für Regierungen, Militär und Geheimdienste konzipiert wurde.
Freilich ist das Ausmaß der Überwachung in den Staaten unterschiedlich ausgeprägt. Unter den führenden Wirtschaftsnationen sind die Kontroll- und Überwachungsmechanismen bekanntermaßen in China besonders weit gediehen. Mithilfe des Social-Credit-Systems (auf Deutsch: Sozialkreditsystem) werden die Bürger und Unternehmen entsprechend ihrem Verhalten entweder belohnt oder bestraft. Regelverstöße werden – je nach Schwere – entweder mit Reiseverboten, Kreditlimits oder gar dem Verlust des Arbeitsplatzes sanktioniert. Zu den zentralen Merkmalen des Big Governments im Land der Mitte gehört eine stark ausgeprägte Internetkontrolle und Zensur, so zum Beispiel die Echtzeitüberwachung von Kommunikation, Chats und Suchanfragen, der Einsatz von mehreren hundert Millionen Überwachungskameras im öffentlichen Raum zur Gesichtserkennung und Körperverfolgung sowie die Speicherung biometrischer Daten und der Einsatz von KI zur automatisierten Abfrage biometrischer Daten. Durch die Verknüpfung von KI und Big Data aus unterschiedlichen Quellen (etwa Behörden, Banken, Internet usw.) lässt sich ein umfassendes digitales Profil eines jeden Bürgers erstellen.
Wenn die „Nanny“ zur „Big Sister“ wird
Nicht alle Staaten, auf welche die Bezeichnung „Big Government“ zutrifft, betreiben ihren Kontroll- und Überwachungsfetischismus so exzessiv wie China, Nordkorea oder auch der Iran. Viele Länder praktizieren eine Art „Big Government light-Variante“, die manche Bürger sogar als angenehm empfinden, weil ihnen der Staat persönliche Verantwortung abnimmt. Beispiele hierfür sind die Nanny-Nationen Skandinaviens.
Welches sind die charakteristischen Merkmale, die auf Big Government schließen lassen, selbst wenn die betreffenden Länder dies mit dem Begriff „Wohlfahrtsstaat“ camouflieren?
Hier wären vor allem folgende Kriterien zu nennen:
- Zentrale Steuerung und Überwachung
- Hohe Staatsquoten
- Überbordende Bürokratie
- Starke Regulierung der Wirtschaft
- Hohe Steuern, Umverteilung.
Die Staatsquote – also der Anteil des jeweiligen Staates an der gesamten Wirtschaft des Landes, bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) – sind in vielen westlichen Demokratien hoch und überschreiten die kritische 50-Prozent-Schwelle, von der Altkanzler Helmut Kohl einmal sagte, ab diesem Punkt beginne der Sozialismus. Nach Angaben von statista lag die deutsche Staatsquote im Jahr 2024 bei rund 49,5 Prozent, bei deutlich steigender Tendenz.
„EU-Wallet“ – Bequemlichkeit hat ihren Preis
Big Government ist aber nicht nur in den Einzelstaaten, sondern vor allem auch in supranationalen Zusammenschlüssen wie der Europäischen Union (EU) anzutreffen, wobei es in diesen Fällen wohl Big Bureaucracy heißen müsste. Die zunehmenden Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen werden den EU-Bürgern häufig nach dem bewährten Konzept eines Rundum-sorglos-Pakets verkauft, als praktisches Hilfsmittel für den modernen und aufgeschlossenen Menschen von heute. Man ist ja schließlich nicht dumm, sondern digital.
Das aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenkende Smartphone steht dabei im Mittelpunkt. Es soll gleichsam zum Dreh- und Angelpunkt werden, wenn es künftig um Zugangsberechtigungen und Identifikation geht. Das Ganze firmiert unter der Bezeichnung EU-Digitale Identifikationsbörse (EUDI-Wallet) unter der Leitung des 2023 gegründeten Potential-Konsortiums.
Dahinter steckt ein riesiges internationales Netzwerk aus 155 Organisationen und Unternehmen. Mit der „EU-Wallet“ können Bürger dann viele Erledigungen online am Handy ausführen. Sie erhalten Zugang zu verschiedenen Behörden, können Bankgeschäfte tätigen, auf elektronische Rezepte zugreifen, mobile Führerscheine nutzen und verschiedenste Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sobald sie sich digital identifiziert haben. Dazu benötigen sie einen digitalen Berechtigungsnachweis, der EU-weit gilt. Damit soll künftig vieles einfacher zu handhaben sein und Bürokratie abgebaut werden. Starten soll dieses Projekt im Jahr 2027.
Was so sinnvoll und praktisch klingt, hat natürlich den üblichen Haken: überbordende Kontrolle über den EU-Bürger und seine Daten. Vermeintlicher Datenschutz mündet oft genau ins Gegenteil. Diese Gefahr besteht fraglos auch bei diesem Projekt. Bei einer Identitätsprüfung werden oft mehr Daten verlangt als nötig. Die EUDI wird flankiert durch programmierbares Zentralbankgeld (Digitaler Euro).
London – Europas Überwachungs-Hauptstadt
Die Bürger befinden sich in der eingangs erwähnten „Sandwich-Position“. Auf der einen Seite die Big-Tech- und KI-Giganten, auf der anderen Seite die Staaten mit Big Government und ungebremster Datengier. Es wird viel darüber diskutiert, ob die Chinesen den US-Amerikanern in Sachen KI bereits überlegen sind. Die Antwort lautet, wie so häufig in der Wirtschaftswissenschaft: „Es kommt darauf an.“ Nämlich darauf, welche Anwendungsbereiche der KI man unter die Lupe nimmt. Ein Vorsprung der chinesischen Unternehmen ist vor allem dort auszumachen, wo es um Überwachung und Gesichtserkennung geht, insbesondere natürlich wegen der praktischen Anwendung in der Überwachung der Bürger dieses Landes und aufgrund der staatlichen Förderung jener Unternehmen, die entsprechende Produkte herstellen.
Das chinesische Unternehmen SenseTime zum Beispiel ist weltweit einer der führenden Anbieter von KI-gestützter Gesichtserkennung, wie sie in Städten, auf Flughäfen und in Bereichen mit Zugangskontrollen eingesetzt wird. Zugleich ist das Unternehmen führend in der Zusammenarbeit mit Staaten, die ihre Bürger ebenso rigoros überwachen wie China. Die Face++Plattform des Unternehmens Megvii Technology zählt weltweit zu den präzisesten bei der Überwachung der Bürger.
Aber auch die Europäer werden sowohl durch entsprechende staatliche Maßnahmen als auch durch die Aktivitäten der Tech- und KI-Giganten gläsern und verlieren mehr und mehr ihre Privatsphäre. So gilt zum Beispiel London als die am intensivsten überwachte europäische Metropole. Dass ausgerechnet Großbritannien George Orwell eine Gedenkmünze gewidmet hat (2 Pounds, lanciert 2025) entbehrt nicht einer gewissen Ironie.
Die teils exzessive Datensammlung dient nicht nur der Überwachung und der Kontrolle bis hin zur Erziehung der Menschen. Denn an wen die Tech- und KI-Konzerne ihre Daten auch immer direkt oder indirekt verkaufen, für sie stellt es jedenfalls ein Riesengeschäft dar. Das Geschäftsmodell hat, wie eingangs erwähnt, einen Namen: Überwachungskapitalismus.
Dabei geht es darum, die Verhaltensdaten der Nutzer systematisch zu erfassen, zu analysieren und schließlich zu kommerzialisieren, ohne dass dies den Betroffenen bewusst wäre. Im Vordergrund steht dabei nicht vorrangig das Verhalten der Menschen in der Vergangenheit und Gegenwart, vielmehr versucht man, daraus Projektionen für die Zukunft abzuleiten. Wie werden sich die Bürger künftig verhalten? Systemkonform und angepasst, oder konstruktiv kritisch und selbstbestimmt?
Wenn Daten tatsächlich die neue Währung sind – und daran kann kein Zweifel bestehen – dann sollte man mit ihnen umgehen wie mit Geld: eben sparsam. Wer mit seinen Daten geizt, streicht eine attraktive Rendite ein, die immer seltener wird, nämlich mehr Privatsphäre. In einer Welt, in der Transparenz scheinbar über alles geht, hat der Mensch auch ein Recht auf seine individuellen Geheimnisse. Sogar in den Zehn Geboten steht nirgends: „Du darfst keine Geheimnisse haben“.
Wer aber – weshalb auch immer – seinen ganz persönlichen Daten-Exhibitionismus billigend in Kauf nimmt, sollte immer abwägen, ob der Preis, den er dafür in Form der schleichenden Aufgabe seiner Privatsphäre zahlt, wirklich in einem angemessenen Verhältnis zu dem steht, was man dafür bekommt. Braucht man zum Beispiel wirklich Wearables, also zum Beispiel Smartwatches und Fitness-Tracker, wenn man verhindern möchte, dass seine individuellen Gesundheits- und Verhaltensdaten gesammelt werden?
Bringen uns Geräte mit ständiger Standortverfolgung (etwa Smartphones mit aktivem GPS oder Smart-Home-Systeme) einen erkennbaren Mehrwert?
„Cash ist fesch“ sollte die Parole all jener sein, die noch Wert legen auf weitgehend anonymes Bezahlen. Sollten wir unbedingt die „Einladung“ von KI-Systemen annehmen, die uns kennenlernen wollen, zum Beispiel digitale Assistenten? Das muss letztlich jeder selbst entscheiden.
Für jene aber, die ein selbstbestimmtes Leben außerhalb der Sandwich-Falle führen möchten, handelt es sich wohl eher um rhetorische Fragen.



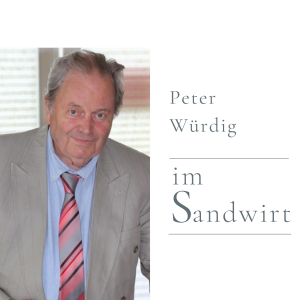

1 Kommentar. Leave new
Herr Brückner, Ihr Essay zeichnet die Sandwich-Position des Bürgers zwischen Big Tech und Big Government anschaulich. Orwell, Zuboff, Palantir, EU-Wallet – alles richtig beobachtet. Doch zwei Fragen bleiben offen:
Was bringt das dem Einzelnen? Sie haben beschrieben, dass Daten die neue Währung sind. Aber Sie haben nicht gesagt, wie der Einzelne diese Währung verteidigen kann – jenseits der Parole „Cash ist fesch“.
Was folgt für Sie selbst? Sie kennen die Mechanik, Sie warnen davor. Aber wie handeln Sie jetzt? Welche konkrete Haltung, welche persönliche Entscheidung ziehen Sie daraus?
Denn Beschreiben allein verändert nichts. Jeder Leser fragt sich am Ende: Und was nun?
Genau dort beginnt die eigentliche Aufklärung – nicht beim „was ist“, sondern beim „was folge ich daraus“.