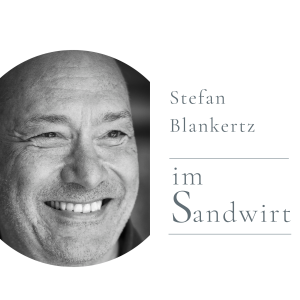Gewöhnlich habe ich einen Widerstand gegen Psychologisierungen, sowohl im privaten wie auch im politischen Feld. Doch der Umgang mit Charlie Kirks Tod legt nahe, dass hier durchaus eine gewisse Reflexion angebracht ist.
In C. G. Jungs Psychologie spielt der Begriff des Archetypus eine herausragende Rolle. Gemeint sind universelle innerpsychologische Cluster. Ich verstehe sie als quasi-virtuelle Persönlichkeiten mit bestimmten Eigenschaften, die situativ aktiviert werden können: Animus, Anima, der jugendliche Held, die Mutter – all das liegt in einer überpersönlichen Bewusstseinsschicht als aktivierbare Kraft. So findet jeder Faust sein Gretchen, die sich vor ihrem geliebten Heinrich eigentlich fürchten sollte (Sie drückt es auch aus: „Heinrich, mir graut vor dir“).
Auch politische Ereignisse laden sich manchmal mit ungeheurer archetypischer Kraft auf: Man erinnere sich nur an die Morde an John F. Kennedy oder John Lennon, nach denen die Toten Rollen erhielten, die weit über das Persönliche hinausgingen.
Eine der stärksten archetypischen Erzählungen ist der Prozess Jesu und die anschließende Kreuzigung: Jesus, eine Mischung aus Lehrer, Reformer und jugendlichem Held, gerät in die Mühlen des jüdischen Establishments. Die Vertreibung der Händler aus dem Tempel und der Einzug in Jerusalem waren wohl die Ereignisse, die die Geschichte des Dissenses auf die Spitze trieben. Für seine Gegner stellte sich die Frage, ob lieber einer geopfert werden sollte oder das ganze Volk, sprich: ihr politisches System. Die Antwort kennen wir.
Bei der Begräbnisfeier Kirks hielt Tucker Carlson eine Rede und brachte Kirk unmissverständlich mit der Jesustragödie in Zusammenhang. Sinngemäß meinte er, dass auch vor 2000 Jahren eine Gruppe „Hummus essender Verschwörer“ den Tod Jesu geplant habe. Nun war auch Charlie Kirk jung, charismatisch, kompromisslos und scheute nicht davor zurück, in der Öffentlichkeit anzuecken. Damit bietet er natürlich einen Ansatz, ihn in den christlichen Archetypus des verfolgten, leidenden Gottessohnes einzuordnen. Wie Jung gezeigt hat, ist dieser Archetyp sogar älter als das Christentum selbst.
Diese Überhöhung in einen Archetypus ist im Kern nicht aufzuhalten. Sie muss nicht einmal propagiert werden – sie drängt sich von selbst auf.
Kirks Witwe hat dem mutmaßlichen Mörder ihres Mannes öffentlich verziehen. Auch das aktiviert archetypische Bilder. Man denke nur an Michelangelos Pietà oder an unzählige Mariendarstellungen.
Nun ist die Tat nur scheinbar geklärt. Schon regen sich Zweifel an dem Narrativ des Einzeltäters Robinson, der angeblich mit einer Mauser von 1906 aus fast 200 Metern einen präzisen Schuss abgegeben haben soll. Das wollen wir hier nicht diskutieren.
Doch eines sei betont: Akzeptiert man die archetypische, vielleicht vielen unbewusste Identifikation Kirks mit Jesus, dann ist damit das Drama der Bibel noch nicht vollständig besetzt. Es fehlen Akteure: der Hohe Rat, das politische Establishment, Herodes, Kaiphas, Judas, der Verrat des Petrus, die Frauen unter dem Kreuz, so manche Salome oder Jezebel, Pilatus – der für manche heute vielleicht nur noch ein Trainer im Bodybuilding-Studio ist, aber dennoch eine universelle Qualität hat. Die Rollen und Positionen müssen mental besetzt werden, und ich vermute, der Kampf darum hat bereits begonnen.
Dass Freunde und vor allem Feinde die psychologische Dimension dessen, was geschehen ist, vielleicht nicht verstehen, hindert sie nicht daran, sie – ich sage einmal – zu vollziehen.
Die Welt scheint sich psychisch verändert zu haben. In der Bibel heißt es, die Erde habe gebebt, Finsternis sei hereingebrochen, und der Vorhang des Tempels sei zerrissen. Nimmt man dies spirituell oder symbolisch, dann ist da etwas dran. Man wird sehen.