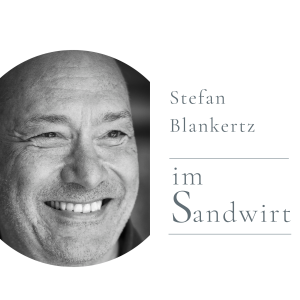Je besser man Frankfurt kennenlernt, desto schwieriger wird es, die Stadt zu hassen. Und wer sich einmal die Zeit genommen hat, die gesamte Berger Straße zu begehen, sich am Wochenmarkt in Bornheim Koriander, gelbe Zucchini, eben die Zutaten für ein gelungenes Abendessen besorgt, der weiß, was ich meine.
Auch das Westend, als Bonzengegend verschrien, schafft es, Gründerzeit-Villen mit klassizistischen Fassaden, Stuckdetails und großen Fenstern einerseits sowie moderne Bürohochhäuser wie den Opernturm andererseits miteinander zu verbinden. Die Mischung aus historischer Eleganz und zeitgenössischer Architektur prägt den Stadtteil, oder anders: Das Westend schafft in einer erstaunlichen Art bautechnisch, das Unmögliche zu verbinden, was man als kleine stilistische Sensation darstellt.
Und wenn Sie nun glauben, ich würde mich mit Architektur auch nur ein bisschen auskennen, so haben Sie unrecht. Alles Wissen darüber habe ich von der Person, weswegen ich überhaupt die Mainmetropole ein wenig besser kenne. Es ist wie immer: Bei aller baulichen und atmosphärischen Schönheit sind es die Menschen, die Orte zu etwas Besonderem machen.
Stichwort Westend. Begeht man den Stadtteil, so bekommt der aufmerksame Spaziergänger sehr schnell den Eindruck, dass dies den inoffiziellen jüdischen Bezirk der Mainmetropole darstellt. Mir fällt kein anderer Ort in Deutschland ein, an dem ich im Jahr 2025 wie selbstverständlich Hebräisch sprechen höre, was wenig verwundert: Das Westend ist stark von jüdischer Geschichte und Kultur geprägt, insbesondere durch die Westend-Synagoge, die 1910 erbaut wurde und als zentrale religiöse Stätte dient.
Viele prächtige Villen, wie die der Familien Rothschild und Goldschmidt, zeugen von jenem Einfluss jüdischer Bürger. Das Ignatz-Bubis-Gemeindezentrum, die jüdische Volkshochschule und das Familienzentrum sollen das jüdische Gemeindeleben fördern, während die „I. E. Lichtigfeld-Schule“ für Bildung als jüdisches Selbstverständnis dienen soll.
Schuld tragen nicht die Täter, sondern die Opfer
Doch wie es so oft ist mit dem Schein: Er trügt. All diese Gebäude müssen 24 Stunden bewacht werden. Eine kleine Polizeiwache soll zusätzlich für sichtbare Sicherheit sorgen, und vor der Schule, die festungsähnlich eingezäunt ist, steht ein Wachmann einer privaten Sicherheitsfirma und kontrolliert, wer das Gelände betritt. Alles ganz normal geworden in Deutschland.
Die Bewohner des Stadtteils dürften es geahnt haben, welche Probleme auf sie zukommen, als angekündigt wurde, dass mehrere Tage lang ein Klima-Protestcamp auf dem Grüneburgpark stattfinden sollte. Und in der Tat ließen die judenfeindlichen Auswüchse nicht lange auf sich warten. Als Aktivisten es gewagt hatten, auf dem Gelände Transparente aufzuhängen, um auf die Geiseln aufmerksam zu machen, die immer noch in den Klauen der Hamas gefangen gehalten werden, wurden diese immer wieder abgerissen.
Der traurige Höhepunkt: Am Freitag schlug der Hass in Gewalt um. Sacha Stawski, Vorsitzender von Honestly Concerned, wurde gemeinsam mit zwei weiteren Juden von einer Aktivistin des Camps attackiert. Farbe ins Gesicht, „Mörder“ ins Ohr – so sieht inzwischen „friedlicher Protest“ im Herzen Frankfurts aus.
Noch bemerkenswerter war, wie die Verantwortlichen des Camps reagierten. Auch ein Vorsitzender der jüdischen Gemeinde war anwesend, als ich eine öffentliche Campführung im Grüneburgpark begleitete. Auf den Angriff angesprochen, wich der „Führer“ des Camps aus. Man werde den Vorfall „intern besprechen“, hieß es, und überhaupt sei es eine Provokation gewesen, mit Plakaten an das Leid der Geiseln zu erinnern. Mit anderen Worten: Schuld sind nicht die Täter, sondern die Juden selbst, die es wagen, auf ihre Opfer aufmerksam zu machen.
Eine ältere Dame brachte diese schaurige Haltung auf den Punkt, als sie in den Raum rief: „Ich möchte das Camp kennenlernen!“ – und jede ernsthafte Diskussion damit abrupt beendete. Das Thema schien die Rentnerin nicht zu interessieren.
Andersdenkende haben keinen Platz
Kurze Zeit später, es war Samstag, der 30. August, zeigte Frankfurt erneut, wie hässlich die Stadt eben auch sein kann. Keine fünf Kilometer vom Stadtteil Dornbusch entfernt, wo Anne Frank ihre Kindheit verbracht hatte, marschierten 10.000 Menschen durch die Straßen. Unter dem Banner „United 4 Gaza“ wurden Parolen gerufen, die an in Teilen importierten Judenhass nichts zu wünschen übrigließen: „From the river to the sea“, „Kindermörder Israel“, „Apartheidsstaat“.
Wer dort stand, hörte keinen Ruf nach Frieden, sondern die altbekannte Forderung nach der Vernichtung Israels – nur verpackt in das Gewand der Menschenrechtsrhetorik.
Schon zu Beginn brachen Teilnehmer das Vermummungsverbot, zeigten Fahnen mit strafbaren Symbolen. Besonders erschütternd: Ein Redner auf einem Lautsprecherwagen verharmloste den Holocaust und das Massaker vom 7. Oktober 2023. Die Polizei nahm ihn fest, doch der eigentliche Skandal war die Reaktion: Der Zug musste anhalten, weil die Menge ihre Solidarität nicht mit den Opfern des Hasses bekundete, sondern mit dem Mann, der die Shoah relativierte.
Andersdenkende hatten in diesem Aufmarsch keinen Platz. Eine Frau mit einem Schild „We believe Israeli women“ wurde angefeindet und geschubst. Nur das Eingreifen der Polizei verhinderte Schlimmeres. Zuvor hatte ein Redner angekündigt, man werde „gleich an Zionisten vorbeikommen“, und jeder wusste, wer gemeint war. Die Frau wurde schließlich von der Polizei zur U-Bahn eskortiert – ein bedrückendes Bild: Ein einzelnes pro-israelisches Zeichen war inmitten von 10.000 Menschen lebensgefährlich.
Es ist nicht genug
So endete der Zug am Goetheplatz, doch die eigentliche, traurige Pointe liegt in Dornbusch: Dort erinnert die Gedenkstätte an Anne Frank, an eine junge Jüdin, die einst voller Hoffnung und Optimismus lebte – bis sie Opfer einer Gesellschaft wurde, die handelte oder wegsah, als der Hass marschierte.
Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass bauliche und atmosphärische Schönheit nicht genug ist. Frankfurt-Westend mag noch jüdisch wirken, doch vor allem und zunehmend sind dort Juden bedroht. Die Berger Straße ist eine reizende Straße, das FSV-Stadion nahe des Johanna-Tesch-Platzes, benannt nach einer wackeren Sozialdemokratin, die von den Nazis im KZ Ravensbrück ermordet worden war, betont den liebevollen Lokalkolorit. Doch es ist nicht genug. Für mich kann jeder Ort, sogar Duisburg, seinen Zauber entfalten. Vielleicht, weil ich selbst zwar einen hohen Heimatbezug verspüre, aber eigentlich keine wirkliche Heimat habe.
Wenn ich von Frankfurt fahre, dann mit der Erkenntnis der eigenen Schuld, aber auch der fremden Fehler: Schöne Orte mag es überall geben, doch es bleibt ein kurzes Vergnügen, wenn die Menschen fehlen, die aus Städten Oasen machen, und die Menschen bleiben, die selbige in Plätze der Hölle verwandeln.
Diesen Beitrag im Wurlitzer anhören:
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.
Alternativ können Sie den Podcast auch bei anderen Anbietern wie Apple oder Overcast hören.