Seit einigen Jahren ist auch die italienische Geschichte nicht vor der postkolonialen Theorie gefeit. Man findet sie mittlerweile vermehrt im angelsächsischen Raum. Die große Frage, warum Norditalien so reich, Süditalien so arm ist, kann nur im marxistischen Sinne interpretiert werden: Ausbeutung!
Da die Gegenwart der Italienischen Republik nicht so recht passen mag – seit der Nachkriegszeit versuchten schon mehrere Regierungen vergeblich, das Problem „von oben“ zu lösen – muss die Vergangenheit herhalten.
Demnach ist das Risorgimento, also die Einigungsbewegung Italiens im 19. Jahrhundert, dafür verantwortlich. Das von Sardinien-Piemont ins Leben gerufene Königreich, das Garibaldis Tausendzug auch um den sizilisch-neapolitanischen Süden erweiterte, hat demnach eine nahezu koloniale Administration im Süden aufgebaut, die auf Steuererhöhungen, Ausbeutung und Ausblutung angelegt gewesen sei.
Nun ist die italienische Einigung mit all ihren Problemen ein alter Hut. Dass der italienische Zentralismus nach französischem Vorbild in einem regional-diversen Land wie Italien zu Problemen führen musste, ist keine Überraschung. Die Halbinsel besitzt eine jahrhundertelange Geschichte von Kleinstaaten, mit ökonomischen, kulturellen, sozialen und historischen teils sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Dazu gesellen sich zahlreiche Dialekte, über die sich Linguisten immer noch streiten, ob sie nur Varietäten, oder eigene Sprachen darstellen.
Kurzum: Nicht nur der Süden hat seine sehr ambivalenten Erfahrungen mit dem Traum von der „Wiederaufrichtung“ des römischen Kernlandes gemacht. Warum sich aber damit beschäftigen? Weil nicht nur der Zeitgeist mit seinen „Empowerment“-Narrativen, Kolonisationsmythen und dem Wunsch nach Feindbildern und Unterdrückten hier eine massive Rolle spielt; sondern auch, weil viele der Probleme, die den Süden Italiens von der Entwicklung im Norden abgekoppelt haben, uns nicht fremd sind.
Es gibt zahlreiche Interpretationsschablonen. Eine allein ist unzureichend. Der Kolonisierungsvorwurf an den Norden geht schon deswegen nicht auf, weil die Süditaliener wie Norditaliener Staatsbürger waren; er geht aber im finalen Sinne völlig fehl, weil das Königreich Sardinien nicht nur den Süden, sondern ganz Italien angegliedert hat. Die Insinuation von Apartheid müsste demnach auch das nordöstliche Venetien treffen. Das galt aufgrund seiner Randlage und Vernachlässigung bis in die Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts als „Sizilien des Nordens“. Bis auf einige extreme Vertreter der venetischen Sezession hat aber niemand in Venetien diese „italienische Herrschaft“ als Kolonisierung verstanden.
Die Emigration, insbesondere um die vorletzte Jahrhundertwende, wird immer wieder als Ausweis des süditalienischen Dramas angesehen. Sie ist aber als Indikator höchst unzureichend. Aus Venetien wanderten im Zeitraum 1876 bis 1915 rund 1,8 Millionen Menschen aus. Für das Piemont – das Herzland der savoyischen Königsdynastie – zählen die Statistiken 1,5 Millionen Auswanderer. Auch der „reichen“ Lombardei kehrten in diesem Zeitraum 1,3 Millionen Italiener den Rücken. Kampanien verzeichnet im selben Zeitraum 1,5 Millionen, Sizilien 1,3 Millionen Emigranten. Der Süden ist dünner besiedelt; aber die Armut des 19. Jahrhunderts ist eher ein gesamtitalienisches Phänomen als eine Geschichte von Ausbeutern und Geschröpften; und wenn, dann erstreckt sich auch letztere Geschichte auf den ganzen Stiefel.
Was in der Tat ein Faktor des Risorgimento ist, der besonders für den Süden zutrifft: Mit der Modernisierung des Südens nach der Einheit stieg der Hygiene-Standard im ehemaligen Königreich beider Sizilien so stark an, dass es zu einem bisher unbekannten Bevölkerungswachstum kam, das zu Landknappheit und Auswanderung führte.
Zuletzt bleibt Venetien als Enigma: Obwohl es nahezu ein Dreivierteljahrhundert als eines der Armenhäuser des Landes galt, gelang der Region nach dem Zweiten Weltkrieg ein überraschender Aufstieg. Hier gab es keine Kampagne, keine staatliche Förderung, kein politisches Eingreifen. Wie passt dies dann mit der vermeintlichen Problematik des Risorgimento zusammen? Liegt der Grund nur im Nichtvorhandensein der Mafia?
Die Antwort lautet: Es ist weniger das Vorhandensein der Mafia, denn die Gründe, die das Entstehen der Mafia im Süden gefördert und im Norden verhindert hat. Dass die Mafia mittlerweile als süditalienischer Import auch Städte wie Mailand infiltriert hat, gehört zu den Umkehreffekten der italienischen Einigung, die den Social-Warrior-Brigaden keine Erwähnung wert sind.
Eine weitere historische Note mag ein Licht darauf werfen, wie kompliziert das Verständnis bleibt, auch aufgrund immer noch wirkender Nord-Süd-Ressentiments bis tief in die akademische Kultur hinein. Der Topos, der Süden sei etwa von den Spaniern im 16. und 17. Jahrhundert ausgepresst worden, zieht sich wie ein roter Faden durch die „pro-meridionale“ Geschichtsschreibung. Dabei stand in exakt demselben Zeitraum mit dem Herzogtum Mailand auch ein reiches norditalienisches Territorium unter derselben Herrschaft. Die Lombarden wurden nicht weniger ausgepresst als die Neapolitaner. Dennoch bleibt Mailand bis heute einer der wichtigsten Wirtschaftsmotoren des Landes.
Auch an dieser Stelle lässt sich erahnen: Nicht die Ausbeutung als solche war das Problem. Ähnlich wie das Risorgimento macht der Fall vielmehr offensichtlich, dass die zugrundeliegenden Strukturen dem Süden zum Verhängnis wurden. Dass die hohen Steuern Süditalien mehr belasteten als den Norden, hing nicht allein damit zusammen, dass sie existierten; sondern weil bereits in der Frühen Neuzeit sich die beiden Teile des Stiefels so auseinanderentwickelt hatten, dass sie auf dieselben Herausforderungen anders reagierten.
Zwischen den Italienischen Kriegen des frühen 16. Jahrhunderts und dem Einmarsch Napoleons im Jahr 1796 gab es lediglich zwei völlig unabhängige Staaten: Den Kirchenstaat und die Republik Venedig. Alle übrigen italienischen Kleinstaaten waren entweder fremdbeherrscht; von einer fremden Dynastie regiert; oder befanden sich wenigstens im Orbit einer anderen Großmacht. Fremdherrschaft war demnach kein bestimmendes, süditalienisches Drama.
Ein weiterer Punkt: Die Geografie. Tatsächlich hat die norditalienische Tiefebene gleich mehrere Vorteile. Der Po und seine Seitenarme bildeten vor Erfindung der Eisenbahn ein natürliches Verkehrsnetz. Mehrere norditalienische Kommunen bauten seit dem Mittelalter ein weit verzweigtes Kanalsystem aus, um die Region über Bootstransport zu verbinden. Mailand etwa war in dieser Beziehung eine Hafenstadt, die von allen Orten der Po-Ebene ansteuerbar war. Das hat später den Bau von Manufakturen erleichtert, die auch auf Güter aus entlegeneren Regionen zugreifen mussten. Historiker haben die starke Urbanisierung des Nordens und die dazugehörige Infrastruktur mit dem England des 18. Jahrhunderts verglichen.
Dass die industrielle Revolution zuerst in England begann und sich dann auf Belgien übertrug, nicht aber im norditalienischen Raum stattfand – trotz der sehr ähnlichen Ausgangsbedingungen von Infrastruktur, Urbanisierung und vermögender Bürgerschicht mit Eigenkapital – hängt an einem weiteren geografischen Faktor: Wallonien und Mittelengland verfügen über Kohleverkommen.
Aber geografische Determination ist nicht das entscheidende Moment für ein Land. Wäre dem so, wäre die Schweiz mit ihrem unwegsamen Terrain heute nicht der Geldschrank der Welt, sondern eine arme Alpenrepublik. Innovationen wie die Eisenbahn haben die Eidgenossen im Herz europäischer Wirtschaftsströme gehalten. Die erste Eisenbahn Italiens wurde nicht in Sardinien-Piemont, auch nicht im österreichischen Lombardo-Venetien – sondern ausgerechnet zwischen Neapel und Portici gebaut. An der mangelnden Begeisterung für Technik lag also das Schicksal des Südens nicht.
Die geografische Frage bringt das Narrativ sogar erheblich ins Wanken: Denn im Frühmittelalter waren es nicht die klassischen Handelsstädte Genua und Venedig, die den Mittelmeerhandel dominierten. Als erste Seerepublik Italiens gilt Amalfi. Sie hatten es dank geografischer Nähe auch deutlich einfacher, in die wichtigen Häfen von Alexandria und Konstantinopel zu kommen. Das Schicksal der reichen Handelsstadt Amalfi bildet auch einen ersten Anhaltspunkt, woran es im Süden haperte.
Denn noch im 11. und auch im beginnenden 12. Jahrhundert verlaufen die Entwicklungen in Nord und Süd noch parallel. Das bestimmende Moment sind die italienischen Stadtkommunen, die Wahl von eigenen Vertretern und der Aufstieg der Kaufleute als Speerspitze städtischen Bürgertums, die für Wohlstand, Öffnung und politische Mitbestimmung stehen. Nicht nur Mailand beschneidet die Macht von Adel und Kirche, indem es eigene Konsuln wählt. Insbesondere an der kampanischen Küste gibt es mit Amalfi, Gaeta und Salerno mehrere Städte, in denen sich kommunale Strukturen und kaufmännisches Leben entwickeln; Neapel steht damals noch im Schatten dieser Orte.
Auch an der apulischen Küste regt sich der kaufmännisch-kommunale Geist, insbesondere in Bari. Die Überführung der Gebeine des Heiligen Nikolaus nach Bari erinnert stark an das Kaufmannsabenteuer venezianischer Händler, die den Heiligen Markus nicht nur aus religiösen Gründen, sondern auch aus Gründen von Identität und Profit (Pilgereinkommen) zu ihrem Schutzpatron küren. Der neue Heilige ist ein Symbol von Selbstbehauptung gegenüber Imperien wie Byzanz, Invasoren wie den Sarazenen und lokalen Adligen. Er gilt damit als Vertreter der kommunalen Ordnung – wie auch in anderen italienischen Stadtstaaten, die sich als Republik des Heiligen Markus (Venedig), des Heiligen Ambrosius (Mailand) oder des Heiligen Georg (Genua) identifizieren.
Die süditalienischen Städte stehen wie die norditalienischen unter der Oberherrschaft eines Großreiches: Während der Süden offiziell Teil des Byzantinischen Reiches ist, ist der Norden de jure Teil des Heiligen Römischen Reiches. Beide Teile des Stiefels profitieren von der Abwesenheit des jeweiligen Kaisers. Im Machtvakuum entwickelt sich die Selbstständigkeit. Die Autonomie ist Garant von Freiheit, Wachstum, Expansion und Blüte. Die Lega Lombarda, die von Mailand ins Leben gerufen wird, bekämpft den „deutschen“ Einfluss auf den Norden auch mit offener Waffengewalt – und setzt sich durch.
Hier verläuft die Bruchlinie. Die südlichen Städte können unter der de jure Herrschaft von Byzanz walten; sie sind aber zu schwach, als sich die Machtverhältnisse in Süditalien mit der Ankunft der Normannen nachhaltig ändern. Zuerst waren die Nordmänner freudig empfangene Söldner, um die aus dem Emirat Sizilien vordringenden muslimischen Angreifer zu bekämpfen. Die Gäste werden jedoch selbst bald zu Landbesitzern. Die Städte akzeptieren die Dynastie aus dem Hause Hauteville (Altavilla), weil sie zuerst die Autonomien der großen Städte garantierten.
Ab dem Hochmittelalter lässt sich eine Zäsur erkennen. Die flächenübergreifende Urbanisierung Oberitaliens hat keine Entsprechung zu Süditalien mehr. Das, was man als eine bürgerliche Gesellschaft mit starken Familienbetrieben, bzw. mit kleinen und mittleren Betrieben bezeichnen würde, oder die Entwicklung hin zu einer Form bürgerlicher Vereinigung, Partizipation und Emanzipation kommt im Süden immer mehr zum Erliegen.
Das Königreich Sizilien, dass die Hauteville formen, verfolgte sehr bald eine zentralistisch-feudale Politik, die lokale Mächte zugunsten eines auf Palermo ausgerichteten Hofes „auf Linie“ bringt. Nicht nur verloren die Handelsstädte das Potenzial, sich ähnlich wie die nördlichen Cousins in Autonomie zu entwickeln und sich im Wettbewerb mit der Nachbarstadt zu messen; die Regierung Kaiser Friedrichs II., des „stupor mundi“, zeigt idealtypisch eine Wirtschafts- und Handelspolitik auf, deren Muster viel zu bekannt vorkommen.
Das gilt selbst für eine der berühmtesten Dekrete des Kaisers, der in Neapel die erste „staatliche“ Universität ins Leben rief. Bezeichnend ist aber nicht nur das Auskommen ohne päpstliche Bestätigung. Viel eindrucksvoller ist der Vorgang, weil er „von oben“ erfolgte. Sämtliche Universitäten Italiens gingen zuvor aus organischen Gründungen „von unten“ aus, mochte es nun als Ableger von Domschulen oder dem Zusammenschluss von Lehrkräften sein. „Universitäten“ entstanden als Vereinigung von Lehrkräften und Studenten, an Orten, wo es die entsprechende Nachfrage und günstige Ausgangsbedingungen gab. Neapel dagegen wurde planerisch gegründet, um Lehrkräfte und Studenten anzuziehen und ein Ausbildungszentrum zu schaffen.
Dieses Denken, das den staatlichen Impuls höher stellt als die kreative Kraft aus dem Bürgertum heraus, zeigte sich auch Jahrhunderte später. Eine legenda negra der italienischen Geschichtsschreibung lautet, der Norden habe den Süden bewusst nicht industrialisiert. Fakt ist, dass sich die gesamte Industrie „des Nordens“ auf das Dreieck Turin, Genua und Mailand konzentrierte. Hintergrund ist aber nicht der Suprematismus, sondern die geografischen Grundlagen: über die Alpenpässe war der Nordwesten an die Kraft- und Ressourcenzentren der deutschen und französischen Ökonomie gebunden, über Genua direkt ans Meer. Erz und Kohle sind in Italien Mangelware. Die Industrie konnte also nur dort erfolgreich sein, wo sie die günstigsten Bedingungen für Import und Export fand, zusammengehend mit dem Kapital der Industriellen in den Metropolen.
Dass Ökonomie und Unternehmertum nicht künstlich erzeugt werden können, hat die Italienische Republik gezeigt, die in den 1960ern ein Stahlwerk in Taranto eröffnete. Es sollte als Großprojekt die Industrialisierung des Südens initiieren, eine autonome Schwerindustrie aufbauen, und Investitionen für ein neues Wirtschaftsnetzwerk legen. Das Projekt blieb ein Monolith, weil es weder aus den regionalen Bedürfnissen hervorging noch auf diese zugeschnitten war. Stattdessen hing Apulien nun an der Stahlindustrie, die spätestens in den 70ern in die Krise driftete. Das Werk wurde subventioniert, weil die Arbeiter und ihre Familien nun davon abhängig waren. Dass es zudem zum Umwelt- und Gesundheitsproblem wurde, steht auf einem eigenen Blatt.
Zurück ins Hochmittelalter. Friedrich verfolgte handelspolitisch eine prä-merkantilistische Politik. Das damals noch reiche Sizilien erlebte eine Politik von Staatsmonopolen, Zöllen und öffentlich bewachten Abfertigungsstellen (Fondachi), über die die Krone jeden Außenhandel kontrollierte. Rohstoffe wurden durch königliche Agenten aufgekauft und abverkauft. Selbst das von Friedrich privilegierte Venedig durfte nur unter strengen Kontrollen aus Sizilien importieren. Private Ausfuhrgeschäfte verbot der König – insbesondere gegenüber den genuesischen Kaufleuten. Der organische Kornhandel, der den Reichtum Siziliens ausmachte, wurde gedrosselt und in die engen Linien der friderizianischen Wirtschaftspolitik gepresst.
Die Merkantilisierung Siziliens im 13. Jahrhundert war eine Demonstration monarchischer Macht, zeigte jedoch die bekannten Schwächen. Venedig, Pisa und Genua unterliefen die Auslieferungen über Schmuggler. Der Bürokratieapparat wurde zur Last. Händler bezogen ihr Getreide nun lieber aus dem Schwarzen Meer oder Nordafrika. Die Krone profitierte zuerst vom fiskalischen Kalkül, bis es zu den ersten Verknappungen kam – wenn der Export keinen Profit mehr abwarf, stellten die Anbieter die Produktion ein. Gegen die flexiblen und international vernetzten Seerepubliken hatte die starre Politik keine Chance.
Der merkantilistisch-zentralistische Ansatz prägte Sizilien auch nach dem Ende der staufischen Herrschaft. Nach der Aufteilung Siziliens in einen aragonesischen (Sizilien mit Palermo) und einen angevinischen Teil (Süditalien mit Neapel) nahmen diese Tendenzen noch zu. Das Haus Anjou zentrierte die Macht in Neapel. Die Stadt errang eine solche Stellung, dass die organisch gewachsene Stadtkultur des Südens kaum damit konkurrieren konnte. Die stolzen Hafenstädte degenerierten zu bloßen Provinzstädten. Ab dem 15. Jahrhundert trugen die muslimischen Korsaren Nordafrikas mit ihren Überfällen, Verwüstungen und Versklavungen zur Entvölkerung der südlichen Küsten bei.
Der Verfall und die Bedeutungslosigkeit des Landes im Schatten der übermächtigen Capitale zeigt sich daran, dass das Königreich Neapel über Jahrhunderte den größten italienischen Flächenstaat darstellte – aber dessen Wohl und Wehe einzig vom Königssitz abhing. Die Eroberung der Hauptstadt war nahezu gleichbedeutend mit der Eroberung des ganzen Landes.
Grund dafür war auch die immer stärkere Zunahme der Stadtbevölkerung. Die verarmten Landbewohner suchten in Neapel ein besseres Leben. Das entzog dem restlichen Teil des Landes Potenzial, Ressourcen und Arbeitskraft. Bereits im 18. Jahrhundert war Neapel mit 300.000 Einwohnern die größte Stadt Italiens und eine der größten Städte der westlichen Welt. Der Preis war nicht nur die Verwahrlosung des restlichen Landes – sondern auch soziale Unruhen. Die Könige hielten den wachsenden, „Vierten Stand“ der lazzaroni mit Brot und Spielen bei Laune, um nicht Opfer des Aufstands zu werden. Statt strukturelle Probleme zu lösen, die den Süden reformierten, vertagte man die Probleme mit subventionierten Brotpreisen: Betäubung statt Eigeninitiative lautete die Devise.
Zugleich schufen die Erfahrungen mit einem autoritären Staat und die Sorge um die soziale Sicherheit ein Klima, in dem Gemeinschaften entstehen konnten, die der Camorra und der Cosa Nostra ähnelten. Es ist nicht ohne Ironie, dass der Staat repressiv und gnadenlos gegen seine Untertanen vorgehen und ihn steuertechnisch erpressen und ökonomisch die Fesseln an die Füße legen konnte, sowie hart gegen Aufstände vorging, die mehr Autonomie forderten; andererseits sich völlig hilflos gegen Bandenkriminalität, Clanstrukturen und organisierte Kriminalität zeigte.
Auch dieses Paradoxon ist heute bekannt: Während das Volk unter Ausbeutung ächzt, gibt es Teile des Staatsterritoriums, die längst nicht mehr unter Kontrolle stehen. Nicht nur das gibt einen Vorgeschmack darauf, dass die Zukunft Westeuropas in vielen Belangen der süditalienischen Vergangenheit – und Gegenwart ähnelt.




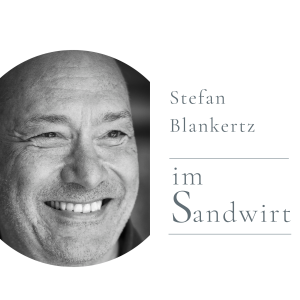
1 Kommentar. Leave new
Sehr spannende Perspektive auf die Normannen und Friedrich II. von Sizilien. Bei Wikipedia lese ich folgende Passage, die dazu passt:
„Jacob Burckhardt meinte in seiner 1860 veröffentlichten Darstellung über die italienische Renaissance, Friedrich sei der „erste moderne Mensch auf dem Throne“. Burckhardts Urteil war jedoch negativ gemeint. Für ihn war das von Friedrich im Süden geschaffene „moderne“ Staatswesen ein absolutistischer Machtstaat orientalischer Prägung.“