Freuen Sie sich gefälligst – uns geht es gut! Das Mantra kennt man spätestens seit dem Tag, als das „beste Deutschland aller Zeiten“ aus dem Feuilleton der Presse hinauf in das Amt des Bundespräsidenten stieg. Ausgerechnet im Corona-Herbst 2020 betonte er neuerlich, wie gut es uns eigentlich ginge, wie frei das Land sei – während kurz darauf der nächste Lockdown als „Wellenbrecher“ begann und bald verschärft wurde.
Ähnlich muss man einen Beitrag des ZDF einordnen, demnach es uns besser denn je ginge. Anschaffungen seien billiger geworden, man habe ein hervorragendes Gesundheitssystem. Während bereits ein kurzer Praxisbesuch den Vormittag wegen Warteschlangen sprengt und die Inflation der letzten Jahre hinweggeredet wird, versteigt sich der Kommentar dazu, ein freiwilliges soziales Jahr sei richtig, schließlich gelte es, die Demokratie zu verteidigen.
Indes geht ein regenreicher Juli vorüber, und natürlich war auch dieser sommerarme Monat ein Beleg für Hitzerekord und Klimawandel. Ein Medienformat nahm gar das diffuse Gefühl der Bevölkerung auf, warum das Wetter zwar den Anschein erwecke, kalt zu sein, aber wissenschaftliche Daten ein anderes Bild ergäben.
Immer wieder stellt der Medienkosmos sich und seinen verbliebenen Anhänger die Frage: Was ist die Ursache für den Hass? Den Populismus? Den Aufstieg der AfD? Die Antwort könnte manches Gemüt dieser Blase erschrecken. Sie sind es größtenteils selbst. Zahlreiche Dokumentationen der letzten zehn Jahre wollen den Ursachen auf den Grund gehen. Etwa alternativen Medien, populistischer Hetze oder Verschwörungstheorien.
Diversität unter dem Dach der Einheitsmeinung
Die Wahrheit ist allerdings: Grund für die Entfernung vom konsensuellen Massenstrom sind nicht so sehr die „Einflüsterungen von außen“, denn die Ablehnung von innen. Es ist nicht so sehr der Umstand, dass Teile der Bevölkerung sich von den Massenmedien entkoppelt hätten, weil sie die alternativen Medienformate entdeckt hätten; eher ist es so, dass die alternativen Angebote sich aufgrund der größer werdenden Nachfrage entwickelt haben. Wenn Menschen die Diskrepanzen zwischen dem Blick aus dem Fenster und dem Blick auf den Bildschirm feststellen, werden sie sich nicht dazu entscheiden, die Fensterläden zu schließen.
Hier spannt sich der Graben auf. Ein nicht geringer Teil des Establishments, ob bei Parteien oder Medien, glaubt nach wie vor, ihre Schäfchen seien lediglich dem falschen Hirten nachgelaufen. Auch deswegen wird gerne das Bild des „Rattenfängers“ bemüht. Die Metapher zeigt allerdings mit den vier anderen Fingern zurück. Hinter der Vermutung, die Abtrünnigen seien verführt worden, steht der eigene paternalistische Impuls, man müsse an die richtige Hand genommen werden, um die Welt zu verstehen. Wer immer die Tagesschau konsumiert, die Zeit liest und an den Universitäten seinen Abschluss gemacht hat, muss per se dem Lastwagenfahrer aus Chemnitz überlegen sein; dass dahinter nicht Mündigkeit, sondern Training steckt, ist den wenigsten bewusst.
Dass ihre Konditionierung nicht besser, sondern lediglich anders ist, findet in der Echokammer der richtigen Meinung keinen Platz. Daher ist der Dissens so schwer erträglich. Die Möglichkeit, dass es auf der „rechten“ Seite gebildete, einfühlsame, nachdenkliche, gewissenhafte Menschen gibt, erscheint abwegig; sie müssten dann ja einsehen, dass sie auf der falschen Seite stehen. Wer „rechts“ ist, ist per se Demagoge. Wenn er schlau ist, dann höchstens, um Leute zu manipulieren. Ansonsten grassiert der Vorwurf der Bösartigkeit oder Dummheit; die Analyse der Situation findet auf der Höhe eines Disney-Schurken statt. Im Übrigen ist auch das andere Lager nicht gegen solche Schablonen gefeit.
Auffällig ist, dass der heutige Gegensatz nicht zuletzt in der Frage nach Konformismus und Nonkonformismus liegt. Obwohl die Meinungsführer der Gegenwart „Diversität“ betonen, wollen sie zwar überall „bunt“ sein – in Sexualität, Abstammung, Lebensentwürfen – verordnen dies aber unter dem strengen Dach der Einheitsmeinung. Der Spielraum ist demnach der Spielraum eines sowjetischen Stils: freilich dürfen alle Völker der Sowjetunion nach ihrem Gusto leben, solange es der Parteigesinnung entspricht. Vor zehn Jahren, mit Beginn der Migrationskrise, haben die Deutschen dieses gewaltige Korsett gespürt, als es nicht nur in den Medien, sondern auch im Alltag zum Stigma wurde, eine andere Meinung zu vertreten als die von NGOs, Leitmedien und Regierung.
Propaganda im neuen Gewand
Dass es eine sehr schlechte Idee ist, seinen Auftrag zur Gewissensbildung an die Regierung abzugeben, besonders, wenn sie auch noch von den Medien flankiert wird, sollte stutzig machen; nicht einmal wegen der besonderen Geschichte Deutschlands, sondern der allgemeinen Geschichte des 20. Jahrhunderts. In der Diktatur mag so ein Schulterschluss gangbar sein, in der Demokratie hängt ihm Ruch an.
Der Konformismus ist immer ein Totalitarismus. Er arbeitet nicht mit Waffen und Gefängnis. Aber er arbeitet mit den psychologisch selben Mitteln. Der Instinkt, „dabei sein zu wollen“, ist tief in der menschlichen Seele angelegt. Er ist gesellschaftlich stabilisierend, wird aber dann fatal, wenn die Angleichung den Verlust der eigenen Identität abfordert. Die traurige Lektion der vergangenen beiden Jahrzehnte ist, dass das Individuum nicht an Wert gewonnen, sondern verloren hat. Darüber dürfen auch Phänomene wie die Atomisierung der Gesellschaft nicht hinwegtäuschen; denn die Atomisierung findet nicht aus individueller, gewissengeprüfter und unabhängiger Prüfung, sondern aus Nachahmung statt. In den sozialen Medien ist die alleinstehende, ungewollt kinderlose Frau ein Meme geworden, die ihre Entscheidung bereut. Aber warum? Man hatte ihr doch ein Leben lang gesagt, dass andere Dinge deutlich wichtiger seien als etwa Kinder zu bekommen.
Beispiele wie diese gibt es viele; es steht aber exemplarisch dafür, dass die vermeintliche Individualität, die heute als Grund für den Niedergang herbeigezogen wird, nicht das tatsächliche Problem ist, sondern weiterhin Masse und Indoktrination. Das tiefere Problem ist vielmehr, dass die Propaganda der Gegenwart nicht mehr der Propaganda der 1930er ähnelt. Paradoxerweise haben insbesondere in Deutschland viele Menschen ihr Gespür für Propaganda verloren, weil sie schematisch auf ein antiquiertes Propagandabild getrimmt wurden.
Wenn an Bahnhöfen die Transideologie beworben wird, wenn nur die Regenbogenfamilie auftaucht, wenn die Staatsdoktrin mit „Demokratie schützen“ beworben wird, dann ist dies Propaganda. Propaganda ist daran zu erkennen, dass sie nicht das Denken anregt, sondern einen Gedanken einpflanzen soll. Dass sie an Bahnhöfen, auf Plätzen, vor Behörden, an Museen und anderswo im öffentlichen Leben breiten Raum eingenommen hat, ist nur aufgrund der Konformität möglich, die Deutschland immer noch im Griff hat. Wer sie anzweifelt, und mag es nur in den eigenen Gedanken sein, der ist zum Renegaten geworden.
Hass, Antikonformismus und der Teufelskreis der Eliten
An dieser Stelle ein Wort zum berüchtigten und sinnentleerten Begriff des Hasses; denn Hass ist per se nichts Schlechtes. Es kommt vielmehr darauf an, wogegen sich der Hass richtet. Die Mehrheitsgesellschaft hasst täglich, aber ihr Hass ist gerecht, denn er wendet sich gegen die Richtigen – man hasst so sehr, dass man seinen Hass nicht einmal als Hass deklarieren will. Denn offiziell heißt es ja, dass Hass getilgt gehört.
Dabei ist Hass – und sein intuitiver Bruder, der Ekel – überlebensnotwendig für eine Gesellschaft, wenn er sich gegen ein Übel richtet. Soll man Ungerechtigkeit lieben? Nach Thomas von Aquin ist Hass sündhaft, wenn er von niederen Beweggründen, etwa Neid getrieben wird. Hass ist allerdings gut, wenn er den Missstand hasst. Hass ist demnach auch mehr als nur Meinung oder Emotion – er ist notwendig, um das Böse zu bekämpfen. Thomas stellt auch fest, dass aus Neid Hass erwachsen kann, aber kein Neid aus Hass – intellektuell stehen heutige Meinungsgrößen meilenweit dahinter, da sie tatsächlich glauben, der Hass sei das Übel, nicht der Hintergrund des Hasses.
Der Antikonformist muss demnach hassen, weil er anders als der Rest das Übel nicht leugnen will. Den Hass zu verbieten, das hieße, einen notwendigen Mechanismus zu töten. Allerdings ist ein solches Hassverbot zwangsläufig, da Politik und Medien weiterhin davon ausgehen, der Bürger werde von außen manipuliert; innere Einsicht gibt es nicht, und wenn, kann sie sich nur zur konformistischen Doktrin bekennen.
Ähnlich sieht es auch beim Parteienverbot aus. Abgesehen von politisch-strategischen Motiven besteht tatsächlich in einem gewissen linksliberalen Milieu die Hoffnung, ein Verbot der AfD würde auch alle Missstände, die damit zusammenhängen, abschaffen. Das ist nur möglich, weil der Glaube besteht, dass die AfD ihr Wahlvolk „verhetzt“ oder „getäuscht“ hätte, und nicht etwa, dass die AfD lediglich eine Nachfrage bedient.
Die Sprengkraft liegt freilich darin, dass ein solcher Vorstoß nicht dazu führen wird, dass sich die verirrten Seelen wieder ins Glied stellen, sondern sich diese lediglich ein anderes Ventil suchen werden. Das völlige Unvermögen der Eliten, einzusehen, dass sie selbst die größten Verursacher der Krise sind, die sie beklagen, führt zum Teufelskreis. Dass dabei der Verfassungsstaat wie die individuelle Freiheit unter die Räder kommen, ist für sie nur Kollateralschaden. Sie werden zu Totengräbern der Demokratie, die sie angeblich verteidigen.



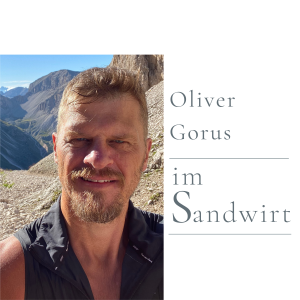
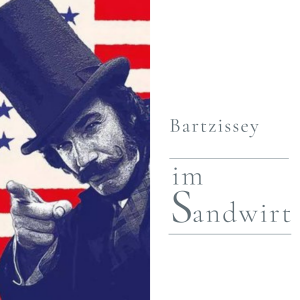
1 Kommentar. Leave new
Herr Gallina, Sie haben den Konformismus als Totalitarismus beschrieben, die Propaganda als neue Form der Einheitsmeinung und den Hass als notwendige Reaktion auf Missstände. Alles drei sind starke Diagnosen, und ich erkenne darin die Schärfe Ihrer Analyse.
Doch ich möchte eine Frage stellen, die Ihr Essay offenlässt: Was folgt daraus für den Einzelnen?
Wenn Konformismus das eigentliche Gift ist, reicht es dann, ihn nur zu benennen? Wenn Propaganda die Fenster verdunkelt, genügt es, auf das Fenster hinzuweisen – oder muss man es selbst öffnen? Und wenn Hass, wie Thomas von Aquin sagt, notwendig ist, solange er dem Missstand gilt: wie übersetzen wir diesen Hass in Handlung, die über Empörung hinausgeht?
Mir scheint, dass wir noch immer im Stadium der Beschreibung stehen. Die Diagnose ist gestellt, die Symptome sind sichtbar – aber was heilt, ist nicht die Wiederholung der Diagnose, sondern die Entscheidung des Einzelnen, sich nicht länger führen zu lassen.
Das wäre für mich die eigentliche Aufklärung: nicht nur das Erkennen des Übels, sondern die Selbstverpflichtung, ihm nicht zu dienen – weder durch Anpassung noch durch Schweigen.