Das System der demokratischen Widersprüche #15
Nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA 2016 und 2024, nach dem Sieg des libertären Javier Milei 2023 mit Hilfe einer konservativen Koalition in Argentinien, nach den Erfolgen der AfD und scheinbar ähnlicher, inhaltlich meist jedoch recht unterschiedlicher Parteien oder Bewegungen in Europa oder anderswo rund um den Globus macht so mancher sich rechtspopulistische Hoffnungen: Der schon immer oder jedenfalls seit langem die westliche Welt beherrschenden Linkskonservativismus könnte zurückgedrängt werden.
Während konservativ-liberale Kreise der Demokratie bis vor kurzem einigermaßen skeptisch gegenüberstanden, da sie Vehikel linker Projekte einer zunehmenden Verstaatlichung und Reglementierung des Lebens sei, werden sie jetzt als Rechtspopulisten zu wütenden Verfechtern der wahren Volksherrschaft. Als Rechtspopulisten mahnen sie an, die Entscheidungen der Mehrheit, die sie nun auf ihrer Seite wähnen, zu respektieren und sich ihnen gehorsam zu unterwerfen.
Die konservativ-liberale Skepsis gegen die Demokratie war allerdings noch gar nicht so alt, ebensowenig wie die Herrschaft der Linken. Während der 1960er, 1970er und 1980er Jahre wurden die Linken stets aufgefordert, sich den Mehrheitsentscheidungen zu unterwerfen. Ihre Proteste und ihre Aktionen galten als undemokratisch, weil sie oftmals nicht von Parlamenten abgesegnet waren.
1980 gewann Ronald Reagan die amerikanischen Präsidentschaftswahlen; auf der linken Seite kam es zu ähnlichen Angstreaktionen wie 2016 und 2025 gegen Donald Trump. Seine Anhänger nahmen die Wahl Reagans hingegen für eine «Revolution», weil er sich stärker als andere republikanische Präsidenten vor ihm (seit der gescheiterten Kandidatur Barry Goldwaters 1964) und nach ihm auf den Liberalismus der Gründungsväter der USA beziehen konnte (wohl auch stärker, als es Donald Trump getan hat, geschweige denn tut).
Da bei Reagan jedoch Rhetorik und Taten besonders weit von einander entfernt lagen, hatten es die Linken leicht, die Folgen seiner keynesianischen, auf Staatsverschuldung aufbauenden Politik einem angeblich «marktradikalen» Neoliberalismus zuzuschreiben. Seither gilt Neoliberalismus als ein Schimpfwort. Dass die republikanischen Präsidenten nach Reagan kaum an ihn anknüpften, sondern eine Politik der Mitte betrieben, die sich gering bis gar nicht von jener der Demokraten unterschied, macht deutlich, wie sehr die Reagan-Revolution am politischen System der Demokratie gescheitert war.
Ich erinnere allerdings hier auch daran, wie sehr F.A. Hayek sich für bremsende Kräfte aussprach, die die Demokratie daran hindern, vorschnelle Änderungen am Etablierten und Bewährten durchzuführen.
In der Folgezeit wurden diejenigen Anhänger der Reagan-Revolution, denen es tatsächlich um ein Mehr an Freiheit und Weniger an Staat ging und nicht nur um Parteipolitik, nachdenklich, was die Demokratie betrifft, und zugänglich für die libertäre Kritik an der Demokratie. Das, was man dann als die «Linke» bezeichnete, die mit der Linken in den Jahrzehnten davor teilweise zwar personell, nicht aber inhaltlich identisch war, hielten nunmehr die Demokratie hoch. Sie versuchten, den Wirkungsgrad der Demokratie in die alltäglichsten Bereiche voranzutreiben und fühlten sich in ihrer Mehrheit sicher.
Seit den ersten Erfolgen der Kräfte, die zusammenfassend als «Rechtspopulisten» bezeichnet werden, kündigt sich eine erneute Verschiebung der inhaltlichen Positionierung von Rechts und Links an. Zwar war der Impuls des «linken» Establishments zunächst, zu einem «Zusammenhalt aller Demokraten» aufzurufen, die Kennzeichnung der Gegner als «Rechtspopulisten» jedoch zeigte, dass es hierbei von Anfang an gegen demokratisch erfolgreiche Gruppierungen ging; denn erfolglose Gruppierungen würde man schwerlich als «populär» einstufen können.
Die Populisten, heute als rechts stehend, vordem als links stehend charakterisiert, fordern wie seit je her Plebiszite und Direktwahlen, weil sie so schneller an die Macht kommen zu können glauben, während die linken Bewahrer auf einmal ihre Liebe zu der schnelle Änderungen bremsenden Kraft des Parlamentarismus entdecken und somit konservativ werden, «rechts». Dann müsste man konsequenterweise die rechten Angreifer aufs Establishments als «links» bezeichnen.
Dass die neuen Herren in den USA und diejenigen, die sich in ihrem Gefolge auch in Europa im Aufwind sehen, das undemokratische Gebaren mit Häme quittieren, mit welchem die Linkskonservativen dem Erfolg des Rechtspopulismus begegnen, ist einerseits verständlich. Auf der anderen Seite ist es genau das, was das politische System jetzt braucht, um seine Stabilität zu wahren: Wie man die ehemalig linken Kritiker des Systems dadurch zur Selbstintegration lockte, indem ihnen Teilhabe an der Macht geboten wurde, so geschieht es jetzt mit dem Rechtspopulismus. Mit der demokratischen Machtübergabe an die Rechtspopulisten unterminiert unser politisches System das Lager der Demokratie-Kritiker.
Für die Libertären geht es erstmal darum, nicht in die Falle zu tappen, nun wieder das System zu unterstützen, weil man meint, es im eigenen Sinne beeinflussen oder gar steuern zu können. Nur in dem Fall, dass die libertäre Demokratiekritik sich strikt daran ausrichtet, inhaltlich nie Position zu beziehen, vielmehr jeder inhaltlichen Position das Recht abzusprechen, sich machtpolitisch durchzusetzen, kann es gelingen, vom tatsächlichen Glanz der Demokratie enttäuschte Linke genauso zu infizieren wie die Konservativen. Wenn dies gelingt, erfüllt sich der Traum von Murray Rothbard einer Koalition für die Freiheit jenseits von Links und Rechts.
Die gegenwärtig zu beklagende Unerbittlichkeit politischer Debatten hat die Neurowissenschaftler Jonas Kaplan, Sarah Gimbel und Sam Harris vom Brain and Creativity Institute (Department of Psychology an der University of Southern California, Los Angeles) beschäftigt. Die Forscher befragten Testpersonen nach ihren politischen Überzeugungen und konfrontierten sie anschließend mit faktisch und sachlich fundierten Gegenargumenten. Die Testpersonen reagierten dogmatisch und rigide, tendierten zu einem starren Festhalten an den vorgefassten «Glaubenssätzen». Vor allem lag die emotionale Reaktionszeit oft unterhalb der Schwelle, die nötig ist, um ein Argument rational abzuwägen. Bei den Testpersonen im Alter zwischen 18 und 39 Jahren handelte es sich ausdrücklich um solche, die sich dezidiert als «liberals» bezeichnen, also dem Milieu zugehören, das ich die Linkskonservativen nenne. Zum Vergleich forderten die Forscher die Überzeugungen der Testpersonen in anderen Themengebieten heraus, auf die sie meist mit Offenheit, Interesse und Diskussionsbereitschaft antworteten. Während dieser Tests wurde die Hirntätigkeit der Teilnehmer mit Hilfe von Computer-Tomographie gemessen. Das Ergebnis der Untersuchung lautet, dass auf die Infragestellung von politischen Überzeugungen eine Reaktion aus der Amygdala erfolge, dem auch als «Mandelkern» bekannten Bereich, der unter anderem zur Verarbeitung von Bedrohungen und Gefahren dient. Daraus folgert das Team um Jonas Kaplan im abschließenden Bericht über ihren Versuchsaufbau, dass jene Infragestellung als ein Angriff auf die Existenz gewertet werde, gegen den man die spontane Abwehr mobilisiere. Das lässt für Diskussionen keinen Raum.
Aus dieser Untersuchung ist der Schluss gezogen worden, in Sachen Politik sei es mit der menschlichen Fähigkeit zum Dialog nicht weit her. Ich fühle mich an Carl Schmitt erinnert, der meinte, das Grundschema der Politik bestehe im Freund-Feind-Denken. Obwohl Carl Schmitt aufgrund des zeitweisen Engagements für den Faschismus, besonders in seiner italienischen Form, bei den Politikwissenschaftlern heute weitgehend diskreditiert ist, gilt seine Feststellung auch und gerade unter demokratischen Bedingungen. Bei den Wahlkämpfen um die Präsidentschaft in den USA Ende 2016 und 2024 war das Schema der Feindbild-Prägung auf beiden Seiten zu beobachten ebenso wie eine zunehmende Verhärtung der politischen Kämpfe und abnehmende Bereitschaft der unterlegenen Seite, ihre Niederlage zu akzeptieren. Für die Bundesrepublik Deutschland ist Ähnliches für die kommenden Wahlkämpfe zu erwarten.
Wer moderne, demokratische Politik nicht für einen Naturzustand hält, der kann aus den Ergebnissen der Forschergruppe um Jonas Kaplan und der Theorie von Carl Schmitt jedoch ganz andere Schlüsse ziehen. Jonas Kaplan und sein Team haben ja festgestellt, dass die Überzeugungen williger zur Disposition gestellt werden, sobald es sich um «nicht-politische» Aussagen handelt.
Wenn Menschen rationaler und offener an nicht-politische Fragen herangehen, könnte man also auf die Idee kommen, dass die Lösung darin besteht, die Politik weniger ernst, weniger «existenziell», weniger wichtig zu nehmen. Was? Politik weniger wichtig nehmen? Was für ein Ratschlag! Damit würde man sich doch den Entscheidungen ausliefern, die Andere über einen treffen!
Genau das ist der entscheidende Punkt: Es wäre infrage zu stellen, dass Andere über mich Entscheidungen treffen können. Noch kurz vor Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 hatte selbst Carl Schmitt während seiner Zusammenarbeit mit dem Liberalen Alexander Rüstow eine «Entpolitisierung» weiterer Teile der Gesellschaft gefordert.
Wenn das Freund-Feind-Schema das Prinzip der Politik ist, dann ist Politik das Problem. Wer politische Überzeugungen eines Anderen infrage stellt, löst damit nicht unberechtigt eine Reaktion in dessen Amygdala aus, sondern er bedroht tendenziell tatsächlich die Existenz des Anderen. Völlig zu Recht fühlt die Person sich bedroht – sobald der Infragesteller die nötigen Machtmittel besitzt, seine Ansichten durchzusetzen, kann er es unabhängig von Sachargumenten tun. Politik stellt die Frage auf der Ebene von Gewalt und bewegt sich damit außerhalb des Bereichs, in dem Toleranz, inhaltliches Argumentieren sowie sachliche Überzeugung zählen.
Als «Demokratie» bezeichnete der österreichische Dichter Ernst Jandl, «unsere Ansichten gehen als Freunde auseinander». Bedauerlicherweise hat er vergessen zu erwähnen, dass Demokratie in der neuzeitlichen Staatsform immer auch heißt, dass die Mehrheit sich rücksichtslos durchsetzt und den Anderen ihre Meinung aufzwingt. Als Freunde können die Ansichten nur in einem entpolitisierten Kontext auseinander gehen.
Die Steigerung von Unerbittlichkeit in den politischen Auseinandersetzungen ist eine direkte Funktion der zunehmenden Politisierung der Gesellschaft. Das alles und jedes bis in die letzte persönliche Intimität «politisch» sei, ist eine der schlechteren Hinterlassenschaften der sogenannten 1968er-Generation. Mit Willy Brandts Parole «mehr Demokratie wagen» in seiner Regierungserklärung vom Herbst 1969 wurde die Politisierung offiziell zur Doktrin in der Bundesrepublik Deutschland erhoben. Heute ist sogar die Frage der Gestaltung von Toiletten Gegenstand von Politik, mit der sich etwa das Berliner Abgeordnetenhaus beschäftigt und über die Mehrheitsentscheidungen herbeizuführen sind. Die Frage, ob ein Konditor in Denver die Hochzeitstorte für ein schwules Paar liefern müsse, erregt weltweites Aufsehen und verlangt nach gerichtlicher Entscheidung sowie gesetzgeberischem Tätigwerden.
Zunächst gab es vor allem von konservativer Seite eine gewisse Gegenwehr gegen die Strategie der Politisierung. Im Augenblick erleben wir leider, dass auch und gerade jene, die den Linkskonservativismus abzulehnen vorgeben, sich der Politisierung bedienen: Sie schaffen die repressiven linken Gesetze nicht ab, sondern kehren deren Inhalt um.
Zuerst formuliert in: Stefan Blankertz, Politik macht Ohnmacht: Demokratie zwischen Rechtspopulismus und Linkskonservativismus, Berlin 2017.
Der Autor dieses Artikels hat in der Edition Sandwirt das Buch „Gegen den Strich gelesen – 12 überraschend freiheitliche Denker“ veröffentlicht.



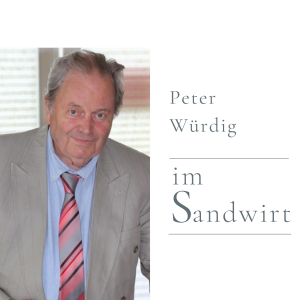

1 Kommentar. Leave new
Zu: „… die westliche Welt beherrschenden Linkskonservativismus …“
Wenn es doch eine konservative Linke wäre!
Das Destruktive ist die Neue Linke, die alle kulturellen Werte, Leistung, wirkliche Arbeiter-Solidarität etc vergessen hat und sich mit faulem Gesocks und sexuell Abneigenden verbündet hat. (Und dabei vom Großkapital finanziert wird.)
Nein, es herrscht im Westen keine konservative Linke.