¡Viva la servidumbre, carajo!
Diesen Text gibt es auch als Episode im Podcast des Sandwirts: Hier.
Viele kennen vielleicht Präsident Javier Mileis berühmten Ausspruch „¡Viva la libertad, carajo!“, was so viel bedeutet wie: „Es lebe die Freiheit, verdammt noch mal!“ – Diese libertäre Aussage habe ich für die Zwecke dieser Kolumne als etatistischen Leitspruch umformuliert in: „Es lebe die Knechtschaft, verdammt noch mal!“
Die Überschrift hätte auch heißen können: „Die Logik des Etatismus“, aber das ist ja eher verhalten für einen Titel. Logik ist hier nicht etwa im Sinne des apriorischen Deduzierens gemeint, sondern im Sinne von Kohärenz, Zusammenpassen, in die gleiche Richtung gehend. Dass etwas also folgerichtig ist, einleuchtend oder konsequent.
Vater Staat
Der Nationalstaat westlicher Prägung, die Verehrung der Nation und „ihres“ Staates, auch Etatismus genannt, geht auf eine im 19. Jahrhundert scheibchenweise kupierte, ja gescheiterte Aufklärung zurück. Die Allegorien des Etatismus sind zu festen gedanklichen Gebilden im Denken und Fühlen der Menschen geworden: Die Obrigkeit, der Staat und seine Organe (als hätte ein geistiges Gebilde Organe wie ein Mensch). Fjodor Dostojewski (1821 – 1881), der im selben Jahr starb als Ludwig von Mises (1881 – 1973) geboren wurde, ließ seine Romanfiguren sinngemäß sagen, dass die Aufklärung zwar mit ihrer Religionskritik erfolgreich war, aber dafür – für die breite Masse der Menschen – lediglich ein anderes „Denkobjekt“ an die Stelle des frömmelnden Gottesbildes getreten war, nämlich der Staat. Er war auf einmal „oben“, wo vorher Gott im Himmel war.
Im 19. Jahrhundert folgte der Staat der damals verbreiteten Logik des Nationalismus, Interventionismus und Militarismus. In der „verspäteten Nation“ Deutschland wurde das 1866 und schließlich 1871 bei der Reichsgründung deutlich. Aus den vorher nur locker in einem völkerrechtlichen „Deutschen Bund“ organisierten Souveränitäten wie Königreichen, Fürstentümern oder Städten wurden – infolge des Deutschen Krieges 1866 – unselbständige Gliedstaaten eines militaristischen Nationalstaates. Das Narrativ von der Nation „kickte“, und wer nicht unter das Joch eines anderen Nationalstaates kommen wollte, der musste seinen eigenen haben. Nahezu jedermann war um 1900 herum Etatist oder Staatssozialist, schrieb Ludwig von Mises.
Sabotage in vielerlei Gestalt
Der Etatismus ist eng verbunden mit dem Militarismus. Im Kriegsfall wird zum Militärzwang gegriffen, wenn nicht gar in Friedenszeiten, denn Krieg droht potentiell ja immer. Die gesamte Wirtschaft dient am Ende dem höheren Zwecke, für den Staat und dessen „Kriegstüchtigkeit“ da zu sein. Mit dem Interventionismus und einem Heer von Verwaltungs- und Vollstreckungsbeamten verfügt man über die jederzeitige Möglichkeit, auf Kriegswirtschaft umzustellen. Dies ist also das geistige Erbe des 19. Jahrhunderts, das heute noch fester Bestandteil im Denken der Volkswirte, Staatswissenschaftler, Kathedersozialisten und dergleichen ist.
Bei der vergleichsweisen geringen Kapitalausstattung des 19. und 20. Jahrhunderts und der damals bedeutend geringeren technologischen Ausrüstung, war der Etatismus als Organisationsform unter den vorherrschenden Bedingungen recht erfolgreich – das ist nicht von der Hand zu weisen. Der militaristische Nationalstaat hat sich nahezu überall durchgesetzt, wo es möglich war, derart große Organisationen zu etablieren.
Dies erforderte Organisationsgeschick, einen maßgeblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung und besondere Verwaltungstechniken, um sich Loyalität und Gefolgschaft zu versichern. Politische Abhängigkeiten wurden geschaffen, Indoktrination wurde institutionalisiert: Zwangsfinanzierter Rundfunk, Schulzwang, Zwangsversicherungen für Arbeiter, Militärzwang, Berufsbeamtentum und dergleichen. Der „Bürger“ wurde wieder Untertan, Verfügungsmasse der etatistischen Nomenklatura.
Etwa eine Dekade nach dem Zweiten Weltkrieg kam es in Deutschland jedoch so weit – man sprach schon von einem Wirtschaftswunder –, als könne die Masse der Menschen mit Ludwig Erhards (1897 – 1977) marktwirtschaftlichem, anti-etatistischen Programm zu Wohlstand gelangen, als den Etatisten das gelegen kam, was später in den linken „Marsch durch die Institutionen“ (Antonio Gramsci, 1891 – 1937; Rudi Dutschke, 1940 – 1979) münden sollte: Die Studentenbewegung der 1960er Jahre, später auch als „die 68er-Bewegung“ bezeichnet. Dieses Phänomen, das sich in allen westlichen Staaten mehr oder weniger schnell ausbreitete, kann man nicht gut erklären, wenn man die Logik des Etatismus nicht versteht.
Denn es war nur folgerichtig, dass man sich als Etatist darüber freuen konnte, dass eine Studentenbewegung auftauchte, die Ziele verfolgte, mit der der Wohlstand der Masse der Menschen erfolgreich verhindert werden konnte. Die Studentenbewegung versprach mehr Etatismus, forderte gar Staatssozialismus. Sie sprach verächtlich vom wachsenden Wohlstand als von der Konsumgesellschaft oder der Wegwerfgesellschaft. Nicht Armut oder Abhängigkeit von staatlichen Leistungen galt es zu bekämpfen, sondern Wohlstand.
Noch dazu wurden konkurrierende Organisationsformen angegriffen, wie etwa die Familie und überhaupt alle Tradition. Alles sollte zentralistisch geregelt werden, vom Staat, besser noch: von einer supranationalen Behörde. Später ging aus den 68ern noch die sogenannte Umweltbewegung hervor, die schließlich darin gipfelte, die Unberührtheit von „Mutter Natur“ als Zielbild über wirtschaftliches Fortkommen zu stellen.
Die Etatisten erfanden sich, gestützt von den neuen linkspopulistischen Narrativen, ein Instrumentarium, um das Streben der Masse der Menschen nach Wohlstand und wirtschaftlicher Souveränität wirkungsvoll zu durchkreuzen. Wirksame Methoden der Wohlstandsbekämpfung waren und sind die Steuerung der Teuerungsrate über Inflation, hohe Steuern, insbesondere Einkommen-, Erbschaft- und Vermögensteuern, Behinderung der Marktwirtschaft durch überbordende Bürokratie, ein ständig anwachsender Staatssektor und – spiegelbildlich – ein immer weniger bis nicht mehr wachsender Privatsektor. Politische Abhängigkeiten müssen erhalten bleiben – so die Logik.
Der souveräne Einzelne
Nach alledem werden Sie die Aussagen von Lord William Rees-Mogg (1928 – 2012) weniger erschüttern, also wie er das Handeln der Politiker und ihrer willigen Unterstützer im Spät-Etatismus im Kampf um ihre Vorherrschaft eingeordnet hat. Lord Rees-Mogg war wahrlich kein „Revoluzzer“, sondern fester Teil des britischen Establishments: Er war Herausgeber der „The Times of London”, stellvertretender Vorsitzender der BBC, High Sheriff of Somerset, Mitglied des House of Lords und Ehrendoktor der Rechte der Universität Bath. In seinem 1999 zusammen mit James D. Davidson verfassten Buch „The Sovereign Individual“ finden Sie Aussagen wie diese:
„Logischerweise und zwangsläufig entwickelte sich Politik aus dem Ringen um die Kontrolle der stark angewachsenen Beute aus der Machtausübung.“
„Politik begann vor fünf Jahrhunderten mit den frühen Stadien der Industrialisierung. Jetzt stirbt sie.“
„Die Macht, Schaden zuzufügen – Dinge zu zerstören, die jemand wertschätzt, Leid und Traurigkeit zu verursachen – ist eine Art von Verhandlungsmacht, die nicht einfach einzusetzen ist, aber oft eingesetzt wird.“
„Regierungen werden Menschenrechte verletzen, den freien Informationsfluss zensieren, nützliche Technologien sabotieren und Schlimmeres.“
Und, last but not least:
„Politiker werden frohen Mutes die Aussicht für langfristige Wohlstandszunahme durchkreuzen, nur um Individuen davon abzuhalten, ihre Unabhängigkeit von der Politik zu erklären.“
Was tun?
Wenn Sie dies lesen, werden Sie manches, was Sie heute in der Politik vielleicht als Fehler, als Mangel an Verstand oder Unvermögen ansehen, anders einordnen: Es ist kein Bug, es ist ein Feature des Etatismus, dass er den Wohlstand der Masse der Menschen bremsen, ja verhindern muss, um politische Abhängigkeiten zu erhalten. Das kann sogar so weit gehen, dass es nach dieser Logik sinnvoll sein kann, sich eine politisch abhängige Wählerschaft zu „importieren“.
Wenn Sie jetzt speziell in Deutschland an gesprengte Schornsteine von neuen Kohlekraftwerken denken, an gesprengte Kühltürme von funktionierenden Atomkraftwerken, an Städte, die planen, ihr Gasnetz abzubrechen, und zahllose weitere Beispiele wie diese, dann verstehen Sie, dass all dies nach der dem Etatismus innewohnenden Logik Sinn ergibt. In etwa so wie es kriegstaktisch Sinn ergeben kann, beim Vormarsch die Brücken hinter sich abzubrechen, damit die Soldaten sehen, dass es kein Zurück mehr gibt.
Dabei – und das ist wichtig – müssen Sie nicht davon ausgehen, dass den Akteuren auf der Polit-Bühne diese Logik des Etatismus vollständig bewusst ist. Aber über was sie meistens verfügen, wenn sie in hohe Positionen gelangen, ist Machtinstinkt. Und wann immer eine Gruppe ein Narrativ pusht, welches eine Ausweitung der Staatstätigkeit, eine Einschränkung der individuellen Freiheit, neue Abhängigkeiten von der Politik und dergleichen verspricht, werden sich die Etatisten auf dieses Narrativ stürzen und versuchen, es für ihre Zwecke dienlich zu machen
Doch was kann man nun dagegen tun? Nun, Mises‘ Lehrer Carl Menger (1840 – 1923) meinte, man könne gar nichts tun, man müsse solche Ideologien sich ganz ausleben lassen. Ludwig von Mises meinte, man müsse beharrlich dagegenhalten und seine Hoffnung auf das Unerwartete setzen, das einem zu Hilfe kommen müsse, damit der Untergang der westlichen Zivilisation doch noch verhindert werden könne. Mises Schüler Murray N. Rothbard (1926 – 1995) wiederum meinte, man müsse sich in die politische Arena begeben und versuchen, an den Torwächtern der Hauptstrommedien vorbei direkt mit der Masse der Menschen zu kommunizieren, und diesen ihre Lage klarmachen. Und die moderne Technik lässt das heute zu, wie ein Javier Milei in Argentinien bewies.
¡Viva la libertad, carajo!
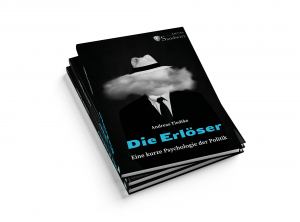 Der Autor dieses Artikels hat in der Edition Sandwirt das Buch „Die Erlöser. Eine kurze Psychologie der Politik“ veröffentlicht.
Der Autor dieses Artikels hat in der Edition Sandwirt das Buch „Die Erlöser. Eine kurze Psychologie der Politik“ veröffentlicht.
Diesen Beitrag im Podcast anhören:
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.
Alternativ können Sie den Podcast auch bei anderen Anbietern wie Apple oder Overcast hören.



1 Kommentar. Leave new
Im August versuchte das Regime von Javier Milei in Argentinien, Anleihen zu verlängern, indem es Investoren einen wahnsinnigen Zinssatz von 69% anbot, und schaffte es nur, 61% davon zu verlängern. Selbst ein Jahreszinssatz von 69% reicht nicht aus, um Investoren dazu zu verleiten, Kredite an das Milei-Ponzi-Schema zu vergeben, was bedeutet, dass sie entweder sehr bald einen Zahlungsausfall erwarten oder davon ausgehen, dass die Preisinflation im nächsten Jahr 69% übersteigen wird. Dies war ein eiskalter Schock für die illusorischen Äußerungen über ein Wirtschaftswunder des Clowns, der sich im Fernsehen als Ökonom des freien Marktes präsentiert und zum Präsidenten ernannt wurde, um Argentiniens größte Industrie wiederzubeleben: das Pump-and-Dump-Geschäft mit Staatsanleihen.
Während seines ersten Amtsjahres nutzte Milei seine freiheitlich-marktwirtschaftliche Fernsehroutine, um vorzugeben, der argentinischen Wirtschaft wirtschaftliche Freiheit zu bringen, brach jedoch sein Wahlversprechen, die Zentralbank zu schließen, und versuchte stattdessen, sie zu retten, indem er ihre Schulden zu den Staatsschulden hinzufügte; er brach sein Versprechen, die Inflation durch eine Verdopplung oder Verdreifachung der Geldmenge zu bekämpfen; er brach sein Versprechen, keine Steuern zu erhöhen; Er beantragte eine Rettungsaktion des IWF und stellte dieselben Banker von J.P. Morgan ein, die Argentinien in Schulden in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar getrieben hatten, um die wichtigsten Positionen in seiner Regierung und der Zentralbank zu besetzen. Alte Gewohnheiten lassen sich nur schwer ablegen, und all das Gerede über den freien Markt im Wahlkampf wich dem gleichen alten Fiat-Banksterismus.
Was hat diese extreme Inflation und Verschuldung Argentinien nun konkret gebracht? Wenn man die wirtschaftlich ungebildete internationale Finanzpresse liest, dann hat Milei ein vermeintliches Wirtschaftswunder vollbracht, weil das BIP-Wachstum wieder angezogen hat, während Inflation und Armut zurückgegangen sind und der Haushalt ausgeglichen wurde. Das ist Unsinn, und die Tatsache, dass dies so stark propagiert wird, spricht Bände über die Rolle, die die internationale Finanzpresse bei der Förderung der Schuldknechtschaft durch den IWF und die Bankster sowie des Bondmarkt-Shitcoin-Casinos spielt.
Alle Diskussionen über einen freien Markt sind leere Rhetorik, solange die Regierung das Geld manipuliert, das Teil jedes wirtschaftlichen Austauschs auf dem Markt ist, und in Argentinien ist die Kontrolle der Regierung über das Geld vollständig. Die Geldmenge nimmt weiter zu, und die Zentralbank schreibt einen Zinssatz von 65% vor, wodurch Spekulationen mit Staatsanleihen die einzige potenziell profitable Branche sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Milei die Inflation, die Steuern und die Staatsverschuldung erhöht hat – die unheilige Dreifaltigkeit der Todsünden für die Ökonomen der Österreichischen Schule, die er angeblich verehrt.
Ohne die Inflation zu beenden, wurden Mileis libertäre und österreichische Wirtschaftstheorien für die unlibertärsten und unösterreichischsten Zwecke missbraucht, die man sich vorstellen kann. Gerade als es so aussah, als sei das Fiat-Anleihe-Ponzi-Schema in Argentinien beendet und nicht mehr zu retten, holten dieselben Bankster, die Argentinien in diese Lage gebracht hatten, diesen Clown aus den Fernsehstudios, um ihn als antiinflationären österreichischen Ökonomen im Präsidentenamt auftreten zu lassen und so die Illusion zu schaffen, dass die Finanzen und der Peso der argentinischen Regierung gerettet werden können. Millionen von Argentiniern dazu zu verleiten, ihre Bargeldersparnisse in Dollar wieder in das schwarze Loch des argentinischen Bankensystems einzuzahlen, und mehr Trottel dazu zu bringen, im Casino mit Staatsanleihen zu spielen, anstatt produktive Arbeit zu verrichten.
All dies hätte vermieden werden können, wenn Milei das getan hätte, was er in seinem Wahlkampf versprochen hatte: die Zentralbank zu schließen.
Ansonsten ein sehr guter Artikel mit Lerneffekt!