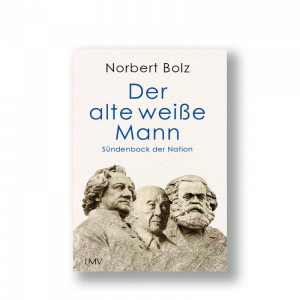(Der folgende Beitrag ist ein Kapitel aus dem Buch „Der alte weiße Mann – Sündenbock der Nation” von Norbert Bolz, das am 17.2.2023 erscheint. Ein Vorabdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags Langen Müller)
Carl Schmitt hat eine Dreifachübersetzung des griechischen Urworts Nomos als Nehmen, Teilen und Weiden vorgeschlagen. Dieser Übersetzungsvorschlag sieht zunächst nach reiner Philologie aus, gewinnt aber rasch eine ungeheure Brisanz. Die einfache Pointe liegt darin, dass man nur teilen kann, was man vorher genommen hat. Das wird vergessen, wenn rechts- und staatsphilosophisch von der ursprünglichen Teilung die Rede ist, in der die Gerechtigkeit sich zeigt, indem jeder das Seine erhält und so das Recht an Eigentum knüpft. Weiden schließlich meint Wirtschaften, also Produktion und Konsum. »Das Teilen bleibt stärker im Gedächtnis als das Nehmen.« Doch wenn man radikal denkt, also die Sache an der Wurzel packt, stößt man immer wieder auf den Vorrang des Nehmens: Landnahme, Eroberung, Kolonisierung, Imperialismus.
Die drei Bedeutungen des Wortes Nomos treten sehr deutlich auseinander, wenn man die drei großen Antworten auf die »soziale Frage« miteinander vergleicht. Der Liberalismus löst die soziale Frage durch das Weiden, also durch die Steigerung von Produktion und Konsum. Der Sozialismus löst die soziale Frage durch das Teilen, nämlich durch radikale Umverteilung der Güter. Hier knüpft der moderne Staat an, dessen Funktion im Wesentlichen darin besteht, das Bruttosozialprodukt umzuverteilen. Der Imperialismus löst die soziale Frage durch das Nehmen, also durch koloniale Expansion. Und Carl Schmitt sagt großartig: »Das Odium des Kolonialismus, das heute die europäischen Völker trifft, ist das Odium des Nehmens.«
Die Schwäche des Westens ist die Schwäche seiner geschichtsphilosophischen Selbstinterpretation. Ihr fehlt eine Nomos-Theorie, und das heißt im Kern der Mut zur Einsicht, dass die Nahme der Grund des Grundes ist; deshalb befindet sich der Westen in der Defensive. In der Tat ist es ja sehr schwer, sich auch nur vorzustellen, wie das gute europäische Gewissen der Nahme in den drei großen Epochen der Kreuzzüge, der Conquista und der Kolonisierung ausgesehen haben mag. Über die Kreuzzüge schüttelt man heute nur noch den Kopf, die Conquista steht ganz im Schatten der Schwarzen Legende, einem seit dem 16. Jahrhundert verbreiteten, propagandistisch überzeichneten Geschichtsbild, und der antikolonialistische Diskurs ist heute ein Ausweispapier der Vernunft selbst.
Im Selbstverständnis des alten Europas gab es eine Dialektik von Nahme und Gabe, die dadurch vermittelt ist, dass der Kolonialismus für den weißen Mann eben auch eine Bürde, eine Last war – »the white man’s burden«, wie die berühmte Formel lautet, die Rudyard Kipling 1898 anlässlich des Spanisch-Amerikanischen Krieges prägte. Der Nomos als Nahme, bei der weiße Gründungsheroen ihre Claims absteckten, hat dem Kolonialismus seinen üblen Ruf eingebracht. Tatsächlich war die Geschichte vor der Moderne in dieser Hinsicht eine Geschichte der Nahme. Aber sie ist eben untrennbar von der Europäisierung als »Gabe« an die anderen Völker, denen aber oft die endogene Motivation fehlte, diese Gabe anzunehmen. Der Philosoph Joachim Ritter hat das in seinem bedeutenden Aufsatz »Europäisierung als europäisches Problem« so formuliert: »Da, wo es den Völkern um die Selbstbehauptung in der modernen Welt und um die Aneignung ihrer Möglichkeiten geht, da sind Wissenschaft und Technik und die Methoden rationeller Produktion und Verwaltung die Gaben, die Europa den Völkern der Erde zu geben hat.«
Aufgrund des stolzen Selbstbewusstsein Europas, das sich im Zentrum einer Menschheit sah, die im Fortschritt begriffen ist, war der Kolonialismus für das 19. Jahrhundert noch ganz unproblematisch. In ihm drängte sich der europäische Geist ganz selbstbewusst dem Rest der Welt auf – im Namen von Fortschritt und Zivilisation. Doch diese Zivilisation hat ihren Preis. Der Philosoph Karl Popper hat das Unbehagen in der Kultur auf den Zusammenbruch der »closed society«, also der Stammesgemeinschaft zurückgeführt. Und es war eben der Kolonialismus, der die »closed societies«, die Tribalismen, imperialistisch aufgebrochen und Kapitalismus wie liberale Rechtsstaatlichkeit gebracht hat. Man brachte ja nicht nur den Handel, sondern auch das Licht der Aufklärung und damit kulturellen Universalismus. Insofern erschien auch noch Cecil Rhodes, britischer Unternehmer und Schlüsselfigur des britischen Kolonialismus – nach ihm wurde Rhodesien, das heutige Simbabwe, benannt – als europäischer Botschafter von Wissenschaft und Fortschritt. Oswald Spengler hat dessen Imperialismus sogar als Schlussform europäischer Rationalität gefeiert.
Der weiße Kolonialismus hat dem Rest der Welt in der Regel zwar keine Demokratie, aber Kapitalismus und Recht gebracht. Und da der Vorsprung des Westens in Wissen, Kapital und Freiheit, der uns grandiose technische und wirtschaftliche Erfolge gebracht hat, immer deutlicher wird, strebt die ganze Welt jetzt nach den materiellen Errungenschaften des Westens. Aber gerade das zwingt uns dazu, an der Idee des Fortschritts festzuhalten. So definiert Friedrich A. Hayek »our task: to continue to lead«. Zu Deutsch: Es ist unsere Aufgabe als Europäer, auch in Zukunft die Führung zu übernehmen.
Die Dialektik des Kolonialismus vermittelt die Idee der Zivilisation mit der Ausbeutung der anderen, Kultur mit Sklaverei. Es ist eine der großartigsten Einsichten von Joseph Conrads Roman »The Heart of Darkness«, dass er die europäische Eroberung der Erde als einen grausamen Vollzug beschreibt, der nur durch eine dahinterstehende Idee, an die aufrichtig geglaubt wird, gerechtfertigt werden kann. Die Zweifel am segensreichen Wirken der Kolonisatoren setzen also schon lange vor dem Ersten Weltkrieg ein. Auf Seiten der Kolonisierten entspricht diesem Selbstzweifel des Westens eine Mischung aus eifersüchtiger Bewunderung einer überlegenen Kultur und ihrer Produkte und dem Ressentiment der Unterlegenen.
Seit die Europäer nicht mehr die Herren der Erde sind, stehen wir am Anfang vom Ende der Geschichte als europäischer. Amerika und Russland sind aufgetreten und haben das Abendland untergehen lassen. 1914 endet dann definitiv der europazentrische Nomos der Erde. Arnold Gehlen formuliert es so: »Die kolonialistische Selbstsicherheit der ohne weiteres in Anspruch genommenen Vorbildlichkeit und Maßgeblichkeit des weißen Mannes ist liquidiert.« Von diesem europäischen Selbstbewusstsein – Max Webers Leitmotiv: »nur im Okzident« – ist nichts übriggeblieben. Stattdessen gibt es die Bußrituale des Antikolonialismus, die regierungsoffiziellen Entschuldigungen für die historischen Nahmen des weißen Mannes.
Schon 1948 erschien eine kurze, überdeutliche Philosophie des Antikolonialismus: Jean-Paul Sartres Essay »Der schwarze Orpheus«. Er verkündet »die große manichäische Spaltung der Welt in Schwarz und Weiß«. Genauer gesagt, die Welt zerfällt in Weiße und ihre Opfer. Das ist die letzte große Erzählung: die Geschichte von der weißen Schuld und dem Sündenbock der Weltgeschichte. Der weiße Imperialismus und Kolonialismus sollen als rassistisches Projekt erkennbar werden. Die Ikone der amerikanischen Intellektuellen, Susan Sontag, wird dann 1967 die weiße Rasse als das Krebsgeschwür der Geschichte bezeichnen.
Was Sartres Essay so aktuell macht, ist seine dialektische Erfindung eines guten, berechtigten »antirassistischen Rassismus« gegen den weißen Mann. Dahinter steht ein ebenso religiöses wie marxistisches Weltbild. Die schwarze ist die »auserwählte Rasse«, die das Leid der Welt auf sich nimmt – ganz analog zur Passion Christi; aber auch ganz analog zum Marxschen Proletariat als dem selbstbewussten Inbegriff der Ausgebeuteten, Erniedrigten und Beleidigten. In der »negritude« vereinigen sich also christliche Passion und proletarische Sendung. Und so wie der Klassenkampf alle Klassen aufheben will, soll der Rassenkampf alle Rassen aufheben. Das Ersatzproletariat der Marginalisierten und Opfer wird dann auch bei Herbert Marcuse eine Schlüsselrolle spielen.
Da Wissenschaft und technischer Fortschritt wesentliche Charakteristika der Kultur des weißen Mannes sind, liegt deren Zerstörung in der Logik des Antikolonialismus. Sartre spricht gar von einem »stolzen Anspruch auf das Untechnischsein« und positiviert damit eine Diagnose, die der Philosoph Max Scheler schon 1927 in seiner bedeutenden Rede »Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs« entwickelt hat. Scheler attestiert hier dem Antikolonialismus die Kraft einer »Gegenkolonisierung« Europas, die er als »systematische Triebrevolte« und Entsublimierung deutet – gegen die Elite, gegen die Weißen, gegen die Männer, gegen die Erwachsenen, gegen den Logos.
Antirassistischer Rassismus bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der weiße Mann diskriminiert werden muss, weil man Diskriminierung nur durch Diskriminierung bekämpfen kann. Der wichtigste Theoretiker der Politischen Korrektheit, Stanley Fish, hat das so begründet: Das Gegenteil von Diskriminierung ist nicht Nichtdiskriminierung, sondern eine andere Diskriminierung. Denn auch wenn man eine Diskriminierung beendet, lebt sie doch in den Denkgewohnheiten der Gesellschaft weiter. Man muss also aktiv eingreifen und bisher diskriminierte Gruppen privilegieren. Dem entspricht umgekehrt, dass man die bisher privilegierten Gruppen, also Weiße, Männer und Heterosexuelle, gar nicht diskriminieren kann. Deshalb darf ein Schwarzer einen Weißen »white trash« nennen, ein Weißer einen Schwarzen aber nicht »nigger«.
Die an den Universitäten gelehrten »Whiteness Studies« bringen den Weißen bei, sich als Rasse zu begreifen, damit man ihnen Rassismus vorwerfen kann. Dabei gilt die Beschuldigung, Rassist zu sein, selbst schon als Schuldbeweis. Und der Weg vom Elfenbeinturm der Geisteswissenschaften zur offiziellen Politik ist mittlerweile sehr kurz. So kann man vom »Regenbogenportal« der Bundesregierung lernen, dass weiß sein heißt, vom Rassismus zu profitieren. Das klingt wie eine säkularisierte Prädestinationslehre: Als Weißer ist es mir von Geburt an bestimmt, ein Rassist zu werden. Da hilft auch kein aufgeklärtes oder »wokes« Denken, denn »weiß« wird als ein Sein definiert. Und wer nun etwa nach wissenschaftlichen Belegen für »strukturellen Rassismus« fragt, gilt rasch als Rassist. Es ist klar, was am Ende dieser Entwicklung steht: Wer nicht aktivistischer Antirassist ist, gilt als Rassist. Wie Antifa und Klimaapokalypse ist auch der Antirassismus eine Ersatzreligion im religiösen Vakuum, das ein sich selbst liquidierendes Christentum hinterlassen hat. Und ihren Jüngern gibt sie etwas zu tun: verbieten, dekonstruieren, zerstören.
Zum Antikolonialismus gehört die These, dass es kein überlegenes, sondern nur unterschiedliches Wissen gibt. Damit bestreitet man alle Universalitäts- und Objektivitätsansprüche. Wahrheit und Wirklichkeit seien nichts als soziale Konstruktionen, die durch Sprachpolitik bestimmt werden. Europäische Rationalität sei nur der weiße Wille zur Macht; Argumente seien Unterdrückungsinstrumente. Wahrheit gilt als Herrschaftsstrategie des weißen Mannes. Moderne Wissenschaft gilt deshalb nur als eine von vielen Formen des Wissens von der Welt. Diese Relativierung und Politisierung der Wissenschaften richtet sich unmittelbar gegen die europäische Kultur. Postkolonialismus, Multikulturalismus und Relativismus sollen die Opfer-Kulturen davor schützen, falsch zu liegen und als rückständig zu gelten.
Der modische Relativismus des »nur für uns« würde zwar gerne alles auf Machtfragen reduzieren. Aber die europäische Rationalität hat den Anspruch auf unbedingte universelle Validität und Autorität. Man darf deshalb vermuten, dass der faule Zauber des Relativismus seine natürliche Grenze in der universellen Gültigkeit von Logik und Mathematik finden wird.
Doch zurzeit haben die Kennworte der antikolonialistischen Ideologie noch einen guten Klang: Diversität, Toleranz, Dialog der Kulturen. Nüchtern betrachtet, muss man aber einfach sagen, dass der Westen sich nicht mehr zutraut, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Der historische Relativismus hat uns in einen Selbsthass der europäischen Zivilisation hineingeführt; die eigene Tradition wird verachtet, alles Außereuropäische wird verehrt. Jeder Angriff auf die Natur des Menschen gilt dem modernen Intellektuellen als intellektueller Fortschritt. Zu Recht hat Papst Benedikt XVI. im Blick auf Europa von einer Apostasie, also einer Abwendung von sich selbst gesprochen.

Wir gratulieren unserem Autor Norbert Bolz zum Erscheinen seines brillanten Buches, dem wir viele Leser wünschen!
Zum Beitrag von Norbert Bolz zu seinem neuen Buch gehts hierlang.